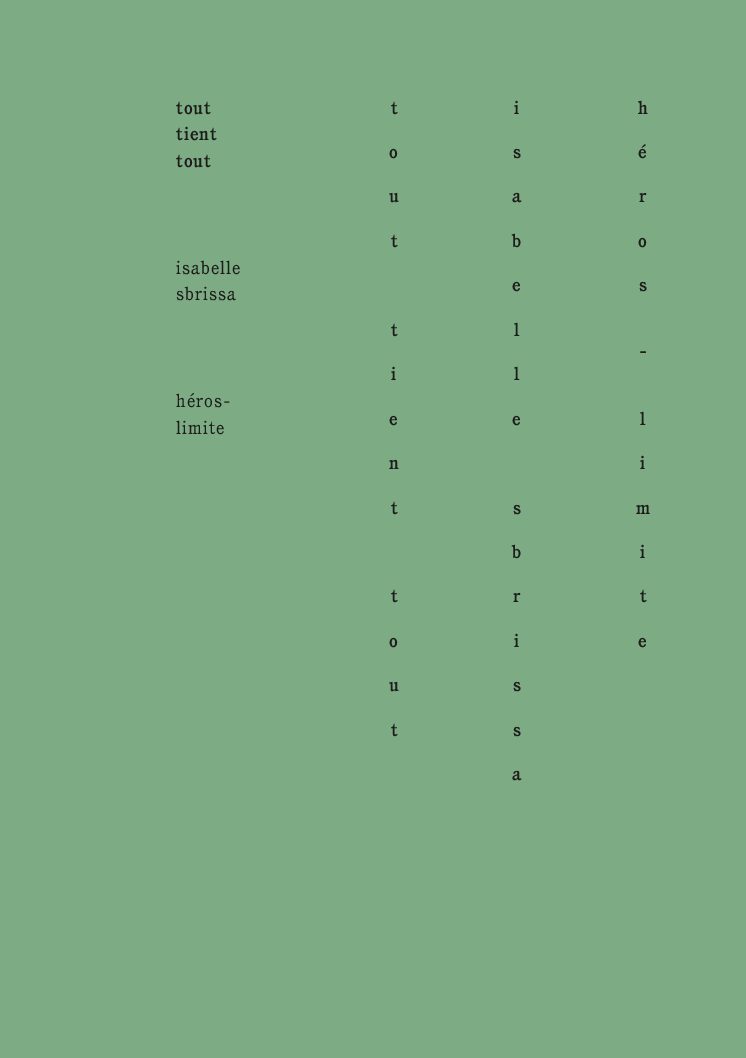Fast genau ein Jahr, nachdem in den USA die Black Lives Matter Proteste infolge des Todes von George Floyd durch Polizeigewalt losgegangen sind, sprechen in diesem Podium drei Autorinnen verschiedenen Hintergrunds über die Identitätspolitik in der Schweiz und in Europa allgemein.
Moderator Martin Dean, selbst Schweizer Schriftsteller und Sohn eines aus Trinidad stammenden Arztes indischer Herkunft sowie einer Schweizerin, erwähnt eingängig, wie die BLM Bewegung auch hierzulande Fuss gefasst habe. Endlich würden auch hier Minderheiten Sichtbar, mehr Programme zur Diversität seien gefragt und in den Verlagen erschienen mehr und mehr POC (People of Colour) als AutorInnen, die auch von einer weissen Leserschaft gelesen würden. Laut Daniel Graf von der Republik geht das Erregungslevel in Sachen Identitätsdiskurs steil nach oben. Entwickelt sich dieser Diskurs in Richtung moralischer Meinungsdiktatur oder sind wir unterwegs zu mehr Sichtbarkeit von Minderheiten und Dekolonisierung der Sprache? Mit dieser Frage eröffnet Dean die Runde und stellt seine Gäste vor.
Als erstes übergibt Dean das Wort an Mithu Sanyal, deutsche Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin. Sanyal ist ihrerseits Tochter einer Polin und eines Inders. Sie liest eine Passage aus ihrem Roman Identitti vor. Im Buch geht es um eine Düsseldorfer Professorin der Postcolonial Studies, die sich Saraswati nennt, sich die Haut verdunkeln liess und sich als Inderin ausgibt, in Wahrheit aber eine weisse Deutsche ist, die Vera Thielmann heisst und aus Karlsruhe stammt. Im Buch beschreibt Sanyal die Nachwehen des Skandals, als diese Tatsache ans Licht kommt und die Diskussionen, die die Hauptfigur Nivedita mit ihrer Professorin daraufhin führen.
Danach übergibt Dean das Wort an Léonora Miano, eine in Frankreich lebende kamerunische Schriftstellerin. Miano spricht über die Situation in Frankreich, die grassierende Polizeigewalt gegenüber POC und die Tatsache, dass Frankreich diesen Identitätsdiskurs ihrer Meinung nach weniger ignorieren kann als die Schweiz.
Zuletzt übernimmt die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger das Wort. Sie spricht die Tatsache an, dass wir in der Schweiz diese Polizeigewalt zwar weniger kennen, das Racial Profiling aber ein grosses Problem darstelle. Elmiger setzt sich mit der bis anhin wenig behandelten Kolonialgeschichte der Schweiz auseinander. Sie merkt an, dass es keine neuen Fragen sind, die im Zuge der BLM Bewegung gestellt würden, sondern sie sind nun einfach prominenter und auch durch Social Media mehr in öffentliche Bewusstsein rückten. Auf die Frage, ob man sich denn mit diesen Themen schon vor 2020 in der Schweiz auseinandergesetzt habe, antwortet Elmiger bejahend, sie seien jedoch eher in Nischen diskutiert worden und verweist auf die Ausschaffungspolitik. Zuletzt liest Elmiger noch auch ihrem Buch Aus der Zuckerfabrik vor, das von Cultural Appropriation handelt und in dem es um den ersten Schweizer Lottomillionär geht, der sich eine Reise in die Karibik gönnt und von da zwei weibliche Holzfiguren mitnimmt.
Nach dieser ersten Gesprächsrunde ergreift Dean wieder das Wort und stellt die Frage in den Raum, ob sich POC heute ausschliesslich als solche bezeichnen dürften, oder ob andere Begriffe wie zum Beispiel «dunkelhäutig» noch akzeptabel seien. Sanyal wirft ein, dass die Frage nach Selbstbezeichnung immer sehr schwierig sei. Sie selbst bezeichnete sich als Kind oft als Ausländerin, obwohl sie in Deutschland geboren worden sei. Es sei aber wichtig, dass Begriffe immer auf die Diskriminierungsgeschichte hinwiesen, zugleich aber auch einen Bezug zur Zukunft hätten. Das perfekte Wort werde es wohl nie geben, aber Sanyal findet es gerade auch schön, immer wieder neue Worte zu finden. Das Problem hierbei sei bloss, dass die Leute oft Angst haben, einen Fehler zu begehen und daraufhin vom Diskurs ausgeschlossen zu werden.
Dean geht dann wieder zu Miano über und spricht das von ihr oft verwendete Wort «afropéen» an. Miano merkt an, dass dieses Wort oft in der Musikbranche Gebrauch findet, wie zum Beispiel im Album From an Afropean perspective der Rapgruppe Cash Crew. Miano hat diesen Begriff dann übernommen und schlägt vor, diesen für die afrikanisch-stämmige Bevölkerung in Europa zu verwenden, die bis anhin noch keinen eigenen Begriff für sich hätten. Ihrer Meinung nach gehe das daraufhin zurück, dass die Bevölkerung Europas im Vergleich zum amerikanischen Kontinent eine bloss weisse Geschichte erzählen könne, wenn sie das wollte, weil die Präsenz von Afroeuropäer*innen in der Gesamtheit der europäischen Geschichte weniger weit zurückgehe und auch zahlenmässig kleiner sei. Sanyal stimmt hier zu, dass Namen für diese hybriden Existenzen extrem wichtig seien.
Abschliessend stellt Dean nun die Frage nach diesen Neubenennungen und was passiert, wenn sie umgangssprachlich werden. Führt diese Betonung von Minderheiten zu einer neuen Verhärtung von Identität? Ist diese Bewegung ein Echo einer vollkommen zersplitterten Öffentlichkeit, wie wir sie in den Medien erfahren? Sanyal sieht die Debattenkultur sehr wohl als gefährdet an und appelliert an eine Rhetorik des Zusammenhalts. Was es brauche, sei die Bereitschaft einander zuzuhören, was andere zu sagen hätten, darüber zu reflektieren und manchmal eben auch unangenehme Sachen zu hören. Nur dadurch könne der Identitätsdiskurs weniger aggressiv geführt werden.