Marie Fleury Wullschleger führt durch die Lesung und das Gespräch mit Autor Vincenzo Todisco und Übersetzer Benjamin Pécoud.
Todisco und Pécoud berichten über ihre Zusammenarbeit bei der Übersetzung von Todiscos Roman Die Echsenkinder. Todisco war überrascht, dass Pécoud konsequent jedes Wort vom Deutschen ins Französische übersetzt hat, wo es bei Übersetzungen oft üblich sei, einige Wörter in der Originalsprache zu belassen. Pécoud begründet dies damit, dass er einer Erzählung, die bereits bilingual sei, nicht noch eine dritte Sprache zumuten wolle. Todisco selbst hat sein Buch danach ins Italienische Übersetzt dabei Pécouds Arbeit oft als Stütze gebraucht.
Danach führt Fleury zur Lesung einer ersten Passage über. Die Passage befindet sich ganz am Anfang des Buches. An dieser Stelle weist Fleury noch auf die Chatfunktion hin und fordert das Publikum auf, Fragen zu stellen. Dann liest Todisco zuerst die deutsche Passage vor und daraufhin Pécoud dieselbe auf Französisch.
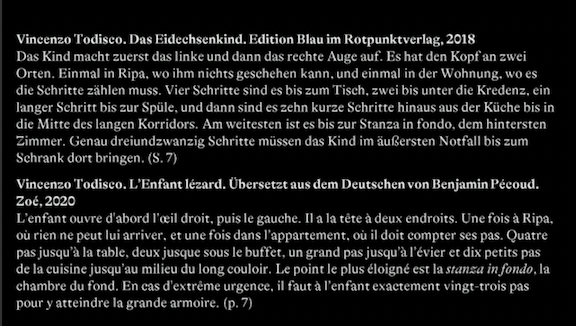
Auf die Frage, wieso sie genau diese Stelle zur Besprechung gewählt hätten, antwortet Todisco, dass man an dieser Stelle gut sehe, wie schwierig es sein könne aus einer germanische Sprache in eine lateinische Sprache zu übersetzen. Im Buch gehe es ja darum, dass das Kind sich verstecke und Todisco wollte dies sprachlich darstellen. Dazu biete sich das Neutrum gut an, denn der Erzähler müsse nicht klarstellen, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen sei, es werde schlicht «das Kind» genannt. Dadurch entsteht eine gewisse Distanz zum Kind, welche sich in der italienischen Übersetzung nicht übernehmen lässt. Mit dem Wort «il bambino» wird sofort verraten, dass es sich um einen Jungen handelt. Das verändert gleich die ganze Erzählweise des Buches.
Dieselbe Frage stellt sich auf Französisch. Denn obwohl man mit «l’enfant» diese Distanz beibehalten kann, wird gleich im nächsten Satz durch das Pronomen «il» verraten, dass es sich um einen Jungen handelt.
Bei der Lesung des nächsten Absatzes kommt bereits eine andere Schwierigkeit zum Vorschein. Die Übersetzbarkeit oder eben Unübersetzbarkeit des Wortes «horchen».
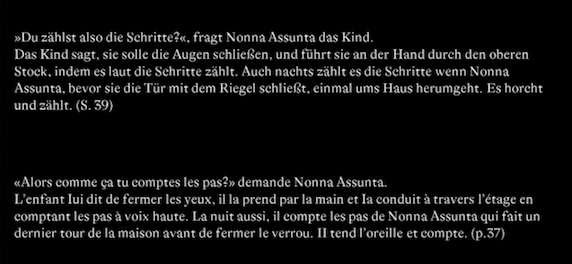
Das Verb «horchen» impliziert eine gewisse Präzision, man hört aktiv zu, man sucht ein Geräusch oder einen Ton. Im Italienischen hat man «ascoltare» (zuhören) oder «sentire» (hören), aber sei eben nicht dieses horchen. Schlussendlich entschied sich Todisco für «tendere l’orecchio» (das Ohr richten). Diese Konstruktion verlange aber noch eine Präzision: man müsse sagen, wohin man das Ohr richtet, womit die ursprüngliche Knappheit verloren geht.
Pécoud stimmt dem zu. Im Französischen biete sich« écouter attentivement» an, was laut dem Übersetzer ein Problem mit der Eleganz darstellt. Es sei nicht so konzise wie «horchen». «Horchen» habe auch etwas Animalisches, was zur Geschichte gut passe, da das Kind als Eidechse beschrieben wird: Es findet eine Metamorphose vom Kind zur Eidechse statt.
In der folgenden Passage geht es darum zu zeigen, wie die Perspektive konstruiert ist.
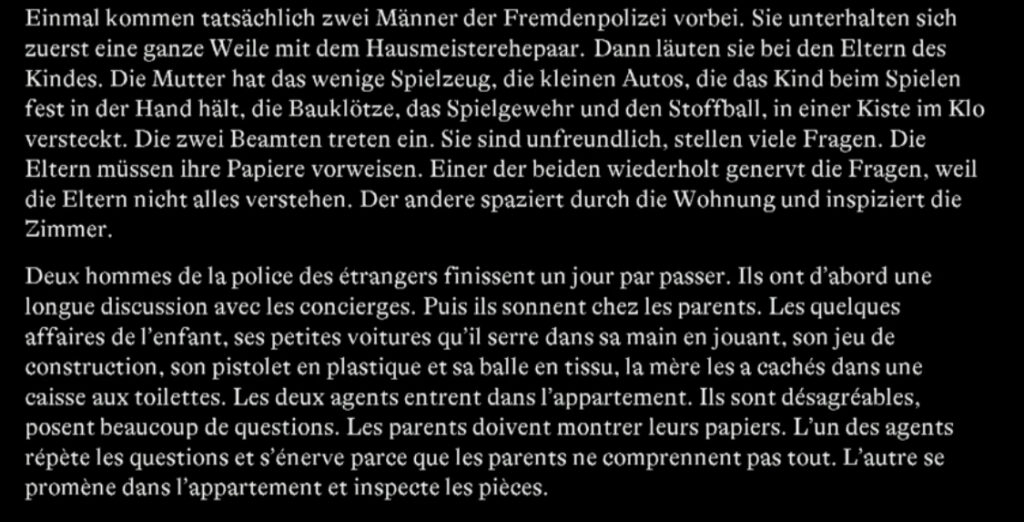
Die Geschichte funktioniert nur, wenn es gelingt, die Perspektive des Kindes beizubehalten. Todisco zieht bei dieser Szene den Vergleich zu Matrjoschka Püppchen. Das Kind ist in einem Schrank, welcher sich in einer Wohnung befindet, diese wiederum befindet sich in einer Stadt in einem fremden Land. Das Kind sieht nur, was man durch den Spalt dieses Schrankes sehen kann. Doch als die Beamten die Wohnung verlassen, droht die Kindsperspektive verloren zu gehen. Todisco löst dieses Problem damit, das Kind die Schritte zählen zu lassen. Hierbei verschiebt sich die Perspektive von der visuellen auf die akustische Ebene, bleibt aber stets die des Kindes. Pécoud fügt an, dass die Perspektive zwar die des Kindes sei, das Kind sei aber nicht der Erzähler. Daher müsse man ein Sprachniveau finden, das weder zu kindlich, noch zu gehoben sei.
An dieser Stelle nutze ich die Möglichkeit, im Chat eine Frage an den Autor zu stellen:
Lieber Vincenzo, hast du durch die italienische Übersetzung einen näheren Bezug zur Hauptfigur gespürt, da das ja die Muttersprache des Kindes ist?
Todisco bejaht dies. Die italienische Sprache zwinge ihn, näher zum Kind zu gehen, da es die Sprache sei, die das Kind selbst spricht. Die Schwierigkeit bestehe darin, trotzdem die zuvor erwähnte Distanz beizubehalten, die das Kind als animalisch und fremd erscheinen lässt. Obwohl die italienische Sprache die Fremdheit der Familie in der Schweiz besser darstelle, schaffe sie zugleich einen näheren Bezug zur Familie selbst.
In der letzten Passage dieser Lesung geht es darum, wie in den Übersetzungen mit Eigen- und Übernamen umgegangen wird.
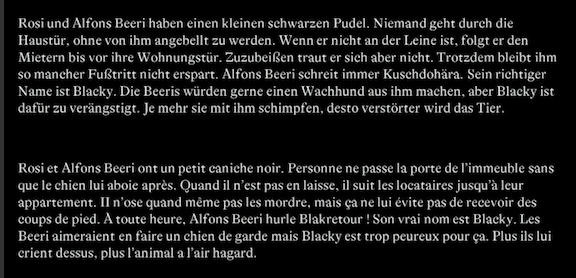
In dieser Passage geht es um die Nachbarn der Familie und deren Hund. Der Erzähler schildert wie Alfons, der Besitzer des Hundes, ihn stets «Kuschdohärä» nennt, obwohl sein Name eigentlich Blacky ist.
Todisco hat in der italienischen Übersetzung diesen Übernamen beibehalten, weil er ihn als etwas sehr Persönliches empfand, was wiederum auf den Charakter des Nachbarn schliessen lässt.
Pécourd wiederum hat diesen Übernamen jedoch ins Französische übersetzt: «Blakretour» heisst er hier. Er begründet dies damit, dass er den Lesenden den Ursprung des Übernamens nahebringen wolle.
An dieser Stelle ergreift Fleury erneut das Wort, um die Lesung doch recht hastig zu beenden. Die Veranstaltung empfand ich als sehr gelungen. Die Auswahl der Passagen gibt einen guten Einblick in das Geschehen und den Aufbau der Erzählung. Zusätzlich ermöglicht die bilinguale Lesung der Passagen Einsicht in die Arbeit des Übersetzens und die damit verbundenen Schwierigkeiten.


