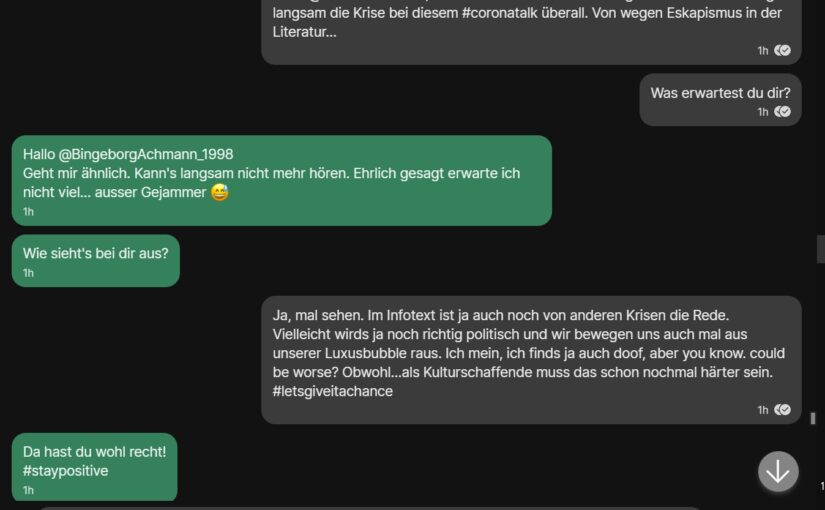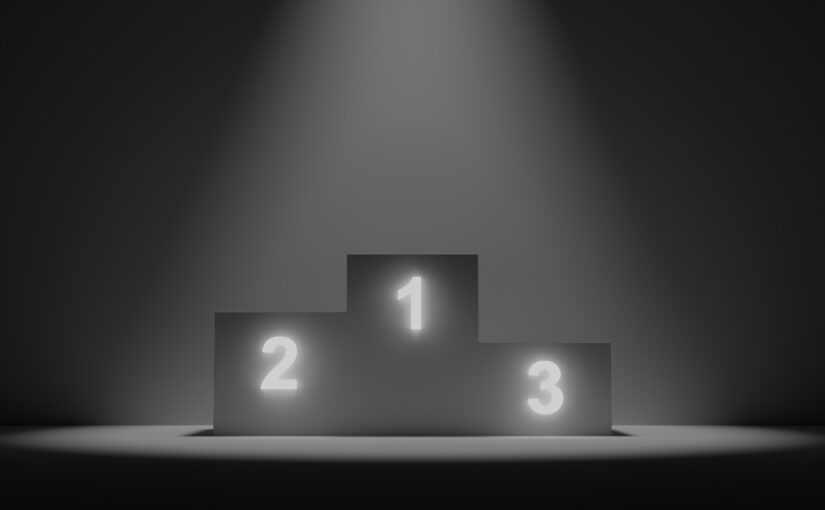von Linus Oberholzer und Katja Lindenmann
«Literatur und Krise» hiess das Podium offiziell. Treffender wäre aber «Corona und drei Schweizer Literaturschaffende» gewesen. Martina Clavadetscher, Gertrud Leutenegger und Alberto Nessi unterhielten sich mit Lukas Gloor über dieses omnipräsente Thema. Zugehört haben Linus Oberholzer und Katja Lindenmann. In einem Chat channelten sie dabei ihre millennial-energy und schrieben mit ihren Alter Egos Kristian_Chracht und BingeborgAchmann_1998 live über die Veranstaltung. Den Chat gibt es hier – mit einem Augenzwinkern − zu lesen.
[16:02] @BingeborgAchmann_1998 #nocoronapunintended hoffe ich doch Krisen über Krisen...take it away Lukas Gloor
[16:03] @Kristian_Chracht Lukas Gloor fragt gleich vorneweg: "Ob die Literatur angewiesen ist auf Krise?" Da bin ich mal gespannt!
[16:04] @BingeborgAchmann_1998 Ich auch! Juhu. Clavadetscher ist dabei. Ich freue mich auf ihren Input à la "Erfindung des Ungehorsams". Gehts dann wohl um Coronaskeptiker*innen? und jetzt auch noch "Panischer Frühling" von Leutenegger, ist das ein Witz oder ein echter Corona-Roman? ...aber nein, es geht ja nur um einen Vulkanausbruch. Und auch kein Cyborg-Coronaskeptiker*innen-merge von Clavadetscher...
[16:06] @Kristian_Chracht Ha! Ich bin also nicht alleine. Auch Clavadetschers Schreiben wurde durch Corona gehemmt.
[16:09] @BingeborgAchmann_1998 Ja, wem sagst du das. Aber das find ich ja jetzt schon spannend. Corona als kreativer Shutdown oder produktiver Lock-in? Ich hab ja auch ganz viele Hobbies dazugewonnen in der Zeit. Aber ich hab ja auch keine Kinder so wie Clavadetscher...
[16:09] @Kristian_Chracht Ja, auf jeden Fall beruhigend zu hören, dass es auch den Profis so geht.
[16:10] @BingeborgAchmann_1998 Ok, shit. Leutenegger kommt gleich zur Sache. Bäm kommt sie rein mit Coronatoten und Menschen am Existenzminimum...#tearinupoverhere ...und jetzt noch so poetisch "Wie fehlt uns die Musik vor Allem" ...ich seh sofort einen Roman vor mir. Aber ob ich den lesen wollen würde? hui und jetzt Italienisch von Nessi. Hast du die Simultanübersetzung gecatcht?
[16:12] @Kristian_Chracht Den ersten Satz hab ich verpasst. Aber jetzt läufts haha
[16:12] @BingeborgAchmann_1998 Haha. Jetzt kann ich sogar noch bisschen Italienisch üben heute..unverhofft.
[16:12] @Kristian_Chracht Nessi machte ja gleich weiter mit schockierenden Bildern. Tote, die im Lastwagen abtransportiert werden... Er schaffte es aber, in den Nächten zu schreiben. Chapeau!
[16:13] @Kristian_Chracht ja, heftig. das find ich jetzt auch ein krasses und irgendwie inspirierendes Bild. Das der sich so in die Nacht zurückgezogen hat. Als hätte das Schreiben während Corona was Verbotenes. Weil es vielleicht grad Wichtigeres zu tun gäbe sonst? Oder ist Kunst mitunter besonders wichtig zu dieser Zeit? Darum sollte es doch jetzt gehen und nicht um das Griechische Wort crisis, das Gloor einwirft und laaange ausführt. da hab ich grad schon etwas abgeschaltet...
[16:14] @Kristian_Chracht Da fällt mir ein Satz eines Dozenten ein: "Wer kein Griechisch kann, kann gar nichts" haha
[16:14] @BingeborgAchmann_1998 hahaha. #truethat wenn es nach Gloor geht. JAWOHL Nessi, ein positiver Krisenbegriff bitte. Den brauchen wir jetzt.
[16:14] @Kristian_Chracht Mal schauen, wie er das meint.
[16:16] @BingeborgAchmann_1998 Nessi ist ja super. Die Krise als Inspiration oder als Impetus würde Gloor vielleicht hören wollen...
[16:16] @Kristian_Chracht Die Krise also nicht als Ursprung des Schreibens. Sie soll lediglich dabei helfen, das, was man zu sagen hat, auch ausdrücken zu können. Wie verstehst du das?
[16:18] @BingeborgAchmann_1998 Hmm...ich habs jetzt so verstanden, dass die Krise halt bewegt und Bewegung bringt neue Perspektiven. Dann kann man vielleicht was sagen, was man sonst nicht auszudrücken vermocht hätte. #imapoettoo
[16:21] @Kristian_Chracht Jetzt ein interessanter Input von Clavadetscher: Die Corona-Krise ist uns zu nahe, um gleich darüber schreiben zu können. Wir brauchen Zeit, um die nötige Distanz dazu zu gewinnen. Und Nessi schliesst gleich an. Es braucht das richtige Verhältnis zwischen Nähe und Distanz zur Krise.
[16:23] @BingeborgAchmann_1998 Ja, finde ich auch spannend. Sowieso der Zeitaspekt. Die Gleichzeitigkeit, die Unmittelbarkeit zur Krise lähmt, wie es Clavadetscher sagt, und dann Nessi, dass alles durch die Coronasituation angehalten wurde. Aber viele sagen doch auch, dass sie jetzt so viel Zeit hätten? #sauerteigbrot Kraut-Funding. haha. good one @Gloor
[16:24] @Kristian_Chracht Haha! Leutenegger ist schockiert! Für sie hat Literatur nichts mit Aktualität zu tun.
[16:24] @BingeborgAchmann_1998 Ja, blick ich nicht. Literatur an die Aktualität rantragen findet sie komisch. Ohaaa, jetzt aber. Journalismus vs. Literatur also. Das geht ja in das rein, was Clavadetscher auch gesagt hat. Je näher am Geschehen, desto eher geht es ins Dokumenatarische.
[16:25] @Kristian_Chracht Ich hoffe, das führt sie noch aus!
[16:26] @BingeborgAchmann_1998 Clavadetscher übernimmt und führt aus: Wenn Literatur auf Aktualität trifft, kann Sprache deformieren usw. Das macht jetzt wieder mehr Sinn für mich. Deformation finde ich da ein schönes Wort. Wie verstehst du das?
[16:26] @Kristian_Chracht Sie findet, dass Literatur durchaus auf Aktualität reagieren kann. Dann aber eher als Spiegel.
[16:27] @BingeborgAchmann_1998 Hm, yesyes. Und jetzt noch eine Anekdote von Leutenegger...ich brauche kürzere Antworten #girlpls
[16:27] @Kristian_Chracht Leutenegger spricht wohl gerne in Bildern haha
[16:29] @BingeborgAchmann_1998 jap. Die Literatur muss nicht das Schlachtengetrümmer der Aktualität zeigen, sagt sie.. hmmm. Ich weiss ja nicht. Sie hat ja schon vorher gesagt, dass sie die unmittelbare Abhängigkeit von Literatur zur Krise als obszön empfinden würde. Also wenn man sagt, dass die Literatur die Krise braucht. Da wolle sie nicht Teil davon sein.
[16:29] @Kristian_Chracht Da sind mir Nessis Aussagen jetzt viel näher!
[16:30] @BingeborgAchmann_1998 same here! Ich verstehe schon, was sie meint. Aber irgendwie bin ich auch eher Team Nessi/Clavadetscher. Obwohl die ja eh alle nicht so riichtig ins Gespräch kommen... Nessi sagt es jetzt ja auch schön: klar, es braucht kein Abbild der Realität. Aber einen Blick darauf.
[16:31] @Kristian_Chracht Genau. Leutenegger findet ja, Literatur könne die Gegenwart nicht beeinflussen. Das ginge lediglich mit Flugblättern usw. Aber das sei dann natürlich keine Literatur. Spezielle Ansicht, finde ich.
[16:32] @BingeborgAchmann_1998 Ich auch. jöh, jetzt hat sie auch noch Italienisch gesprochen. Ihr sei ein Missverständnis passiert. und Nessi nur so: "si, grazie" #grosseskino
[16:34] @BingeborgAchmann_1998 Sie hat also gemeint, sein lyrisches Buch, das sie als Bestiarium beschrieben hat, sei der einzige Beitrag zur Coronakrise gewesen...und dann war sie enttäuscht über sein Corona-Tagebuch, das auch noch rauskam. Ich will beides gerne lesen.
[16:34] @Kristian_Chracht Leutenegger übernimmt mit ihren komplett neuen Inputs ab und an die Rolle des Moderators. Findest du nicht auch?
[16:35] @BingeborgAchmann_1998 voll! Ich wünschte, dass mehr ein Gespräch entstehen könnte. So sehr ich Nessi auch in Italienisch und Französisch gerne zuhöre...da hilft die Übersetzungshürde halt auch nicht.
[16:37] @Kristian_Chracht Total! Und jetzt kommt noch die Resilienz ins Spiel. Trifft ja voll den Zeitgeist.
[16:38] @BingeborgAchmann_1998 Mhm. Und dann noch mit Sigmund Freud... Nessi ist totaler Optimist. Das ist ganz erfrischend. Der schöpft aus der Krise...er spricht ja vom Bewusstsein der eigenen Fragilität, die Corona schafft und die anrege. Uh, da wird Leutenegger auch wieder getriggert.
[16:39] @Kristian_Chracht Mal eine ganz neue Sichtweise. Tut echt gut!
[16:40] @BingeborgAchmann_1998 Immer wieder also die Krise als Katalysator. Mhm. sorry to break it to you, aber Gloor will jetzt über Geflüchtete sprechen. Sicher ein wichtiges Thema! Jetzt wirds spannend...?
[16:40] @Kristian_Chracht Ganz im Stil eines Journalisten. Negativität verkauft sich halt besser haha
[16:43] @BingeborgAchmann_1998 ha! Wobei, ich hatte mir ja gewünscht, dass es nicht nur um Corona in unserer Luxusbubble geht. here we go also: Soziale Fragilität. Jetzt spricht Nessi das direkt selber an...wir seien durch die Krise auf das Essenzielle des Lebens zurückgeworfen und müssen unseren Stolz wegwerfen usw. Tun wir - ich meine jetzt uns Menschchen, die uns hier virtuell fröhlich tummeln können - das aber? #privilegedtothemax
[16:45] @Kristian_Chracht Ein spannender Ansatz. Aber bei der Essenz des Lebens sind wir auch jetzt noch nicht angelangt. Da geht es uns echt zu gut, wie Gloor behauptet.
[16:45] @BingeborgAchmann_1998 you go @Gloor! jetzt bringt er selber "Schweiz-Bashing" rein. und Leutenegger findet die Pandemie bei uns genauso dringlich wie sonst wo auf der Welt...? ok...ganz ehrlich wtf
[16:49] @Kristian_Chracht haha Leutenegger einmal mehr schockiert. Clavadetscher fasst den Gedanken klarer. Sie findet, die Schweiz darf auch als reiches Land Turbulenzen haben. Und wie ich finde hat sie recht, dass man nicht IMMER relativieren soll...
[16:49] @BingeborgAchmann_1998 Jaja, das finde ich schon auch. Es geht halt um ein Bewusstsein. Und das eigene Privileg checken und die eigene Krise dennoch nicht ausblenden - vor allem in Hinblick auf verschiedenste Bevölkerungsschichten - ist mega wichtig. Ich bin froh, hat sie sich hier eingeschaltet. Sie kommt etwas zu kurz, sagt aber immer super spannende Sachen.
[16:50] @Kristian_Chracht Genau. Sie spricht nicht oft. Aber wenn sie spricht, dann immer sehr prägnant.
[16:50] @BingeborgAchmann_1998 Ja, total. Gebe ihr da auch klar Recht: Die Schweiz glänzt nur an der Oberfläche.
[16:50] @Kristian_Chracht Gloor leitet die Diskussion hier in eine gute Richtung.
[16:51] @BingeborgAchmann_1998 Ja, finde ich auch. huh. Und Nessi kommt echt noch einmal mit dem Griechischen... du solltest Recht behalten..oder eher dein Lehrer. Crisis jetzt im Sinne von "Entscheidung".
[16:51] @Kristian_Chracht Ja, leider haha Hier ist das Beispiel durchaus berechtigt.
[16:51] @BingeborgAchmann_1998 Da wären wir ja wieder bei der Bewegung, die Krise auslöst.
[16:52] @Kristian_Chracht Leutenegger bashed jetzt Klischees. Aber recht hat sie!
[16:53] @BingeborgAchmann_1998 Ja. das war jetzt nicht schlecht: Nicht die Schwez ist langweilig, sondern die Klischees sind es. langweilig finde ich eh nicht das richtige Wort... ich finde das spannender, was Nessi auch schon angesprochen hat: Literatur ist in der Schweiz auch ein Luxus. Und aus dieser Perspektive muss man sie auch lesen. Das ist ein Privileg und macht sie aber inhaltlich sicher nicht per se irrelevanter.
[16:54] @Kristian_Chracht Genau, es ist immer eine Frage der Perspektive.
[16:55] @BingeborgAchmann_1998 mhm. und Nessi noch einmal wunderbar: Dass es um das Gewöhnliche geht, das in der Literatur schön gemacht wird. Und dann auch politisch: Wir müssen mit gewöhnlicher Sprache beginnen, für alle und für andere sprechen, sagt er so ungefähr. Finde isch spannend.
[16:57] @Kristian_Chracht Literatur kann vieldeutig sein. Wie Clavadetscher sagt, hat die Literatur ganz andere Spielregeln als die Realität. Und das ist gut so!
[16:58] @BingeborgAchmann_1998 Finde ich auch. Und jetzt zum Abschluss, die Frage, ob die Autor*innen einen Corona-Roman schreiben werden. Klares nein von Leutenegger. Aber hast du ihre genaue Antwort verstanden? Was war das mit der Mitte der Welt?
[16:59] @Kristian_Chracht Ja, etwas gar kryptisch. Nessi bleibt nichts anderes übrig, als ihr einfach mal zuzustimmen haha
[17:00] @BingeborgAchmann_1998 Ja, und dann damit zu ergänzen, was er schon ein paar mal angedeutet hat: er schreibt persönlich. Und in diesem intimen Schreiben ist die Pandemie drin, ohne, dass sie konkret angesprochen wird oder werden muss.
[17:01] @BingeborgAchmann_1998 So und das wars. Ich bin raus. #cherriioo #feierabendbierichkomme tüdelüü Kristian...lass es chrachen^^
[16:51] @Kristian_Chracht haha. Ach Mann. tüdelüü.