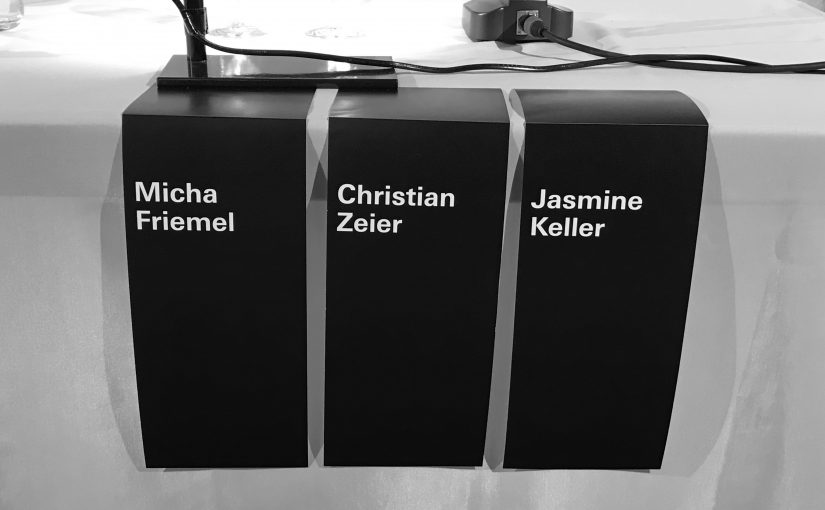Ton statt Bild – so beginnt Lukas Hartmanns Lesung im Solothurner Landhaussaal. Durch den Raum schallt der Dreissigerjahre-Gassenhauer Ein Lied geht um die Welt. Aus einer anderen Welt, aus einer anderen Zeit dringt diese Musik zu den Ohren des Publikums vor. Es dauert ein Weilchen, bis Ruhe herrscht und alle der Stimme lauschen. Es ist dieselbe Stimme, die auch im Zentrum von Hartmanns neuem historischen Roman Der Sänger steht. Hartmann erzählt darin aus dem Leben des bekannten Tenors Joseph Schmidt.
Im Verlauf der Dreissigerjahre verblasste Schmidts Bekanntheit zunehmend, ins Zentrum wurde ein ganz anderer biographischer Fakt gerückt: Schmidt war Jude. Auf der Flucht vor den Nazis legte Schmidt eine Odyssee durch Europa zurück; 1942 gelangte er schliesslich als «illegaler Flüchtling» in die Schweiz. Die Schweiz stellte sich allerdings nicht als der erhoffte sichere Hafen heraus: Im Internierungslager Girenbad starb Schmidt, mangelhaft medizinisch untersucht und betreut, noch im selben Jahr an Herzversagen.
Hört man Hartmann beim Lesen zu, könnte man meinen, man lausche einem Hörbuch – so ruhig, so nachdrücklich, so ausdrucksstark liest der Autor. Nur selten und flüchtig stellt er dafür Blickkontakt zum Publikum her. Ruhig sitzt er da, bis auf seine Lippen bewegt er sich kaum. Nicht sein Körper, sondern vielmehr seine Stimme nimmt Raum ein. Im Gespräch mit Moderatorin Gabrielle Alioth wird klar: Hartmann ist voll und ganz auf das konzentriert, was er gerade tut. Mühelos entspinnt sich ein Gespräch zwischen den beiden: Hartmann gibt lebendig Auskunft und geht dabei besonders auf die Historizität seines Romans ein. «Soweit ich sie herausfinden konnte, stimmen die Fakten», hält er fest. Hartmann, der unter anderem auch Geschichte studiert hat, erzählt davon, wie sich sein Bild von der geschilderten Zeit im Laufe seiner Recherchen verändert habe. Es sei inzwischen «weniger schwarz-weiss», es sei «grauer». Berührt habe in zum Beispiel der Umstand, dass durchaus auch spontane Hilfe aus der Zivilbevölkerung gekommen sei; etwa indem man den Geflüchteten von den rationierten Lebensmitteln abgegeben habe. Dass es aber natürlich auch in der Schweiz überzeugte Antisemiten gab, dürfte selbst den Allerletzten mit der Lektüre von Hartmanns Roman klar geworden sein.
Alioth hat bereits zu Beginn auf die Relevanz des Buches für alle Schweizer*innen hingewiesen, werde hier für einmal das Augenmerk auf die Schweiz zu Beginn der Vierzigerjahre gelegt. Auch macht Hartmann den Bezug zur Gegenwart stark: «Ähnliche Konflikte, ähnliche Polarisierungen» würden immer wieder auftreten. Gegen Ende liest Hartmann die Szene vor, in der die zwischenzeitlich verloren gegangene Stimme Schmidts ein letztes Mal zu ihm zurückkehrt, um dann für immer zu verstummen. Dieser Schwanengesang gibt Schmidt in Hartmanns Roman seine Eigenmächtigkeit, seine Würde, wieder und fördert eine rührende Bescheidenheit zu Tage. Nach dem Applaus ertönt leise Una furtiva lagrima aus den Lautsprechern. Ein guter Moment, um kurz innezuhalten und über den Umgang mit geflüchteten Menschen im Hier und Jetzt nachzudenken.


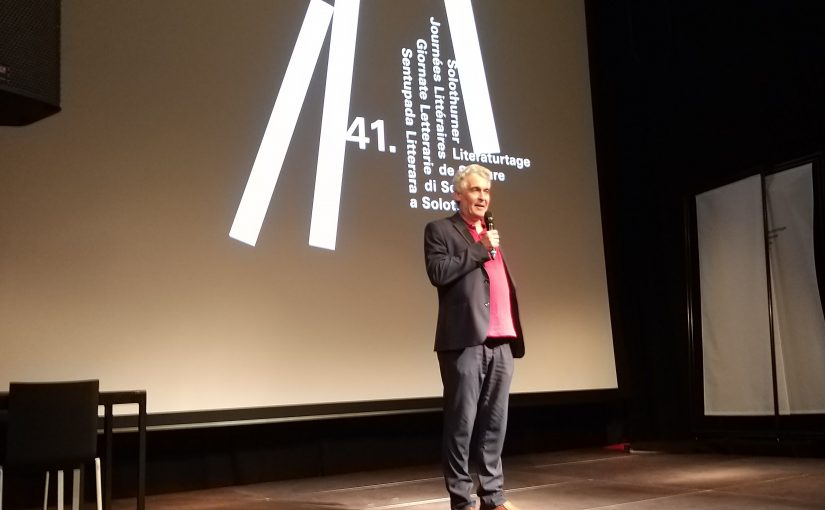
 Die Dokumentation bietet dem Publikum aber nicht etwa eine Selbstdarstellung des Poeten selber – nein – sie begleitet seine Suche nach einem authentischen sprachlichen Ausdruck. Diese Sprache ist es, womit Fabio Pusterla seit Jahren eine tiefgründige und innige Beziehung zu seinen Lesern und Leserinnen zu schaffen vermag. Das Schreiben einer solchen Sprache sei eine grausame und unbarmherzige Kunst, welche ihm viel abverlangen würde – vielleicht zu viel. Wer diesen Weg einschlägt, so sagt Fabio Pusterla, muss bereit sein, sich vielen Prüfungen zu stellen.
Die Dokumentation bietet dem Publikum aber nicht etwa eine Selbstdarstellung des Poeten selber – nein – sie begleitet seine Suche nach einem authentischen sprachlichen Ausdruck. Diese Sprache ist es, womit Fabio Pusterla seit Jahren eine tiefgründige und innige Beziehung zu seinen Lesern und Leserinnen zu schaffen vermag. Das Schreiben einer solchen Sprache sei eine grausame und unbarmherzige Kunst, welche ihm viel abverlangen würde – vielleicht zu viel. Wer diesen Weg einschlägt, so sagt Fabio Pusterla, muss bereit sein, sich vielen Prüfungen zu stellen.
 Die Schreiberlinge meistern die Herausforderung jedoch mit Bravur. Von bibliografischen Erzählungen über humorvolle Gedichte bis hin zu einzigartigen Wortexperimenten – im breiten Angebot der Texte findet sich so ziemlich alles, was in 30 Minuten Bühnenzeit präsentiert werden kann.
Die Schreiberlinge meistern die Herausforderung jedoch mit Bravur. Von bibliografischen Erzählungen über humorvolle Gedichte bis hin zu einzigartigen Wortexperimenten – im breiten Angebot der Texte findet sich so ziemlich alles, was in 30 Minuten Bühnenzeit präsentiert werden kann.