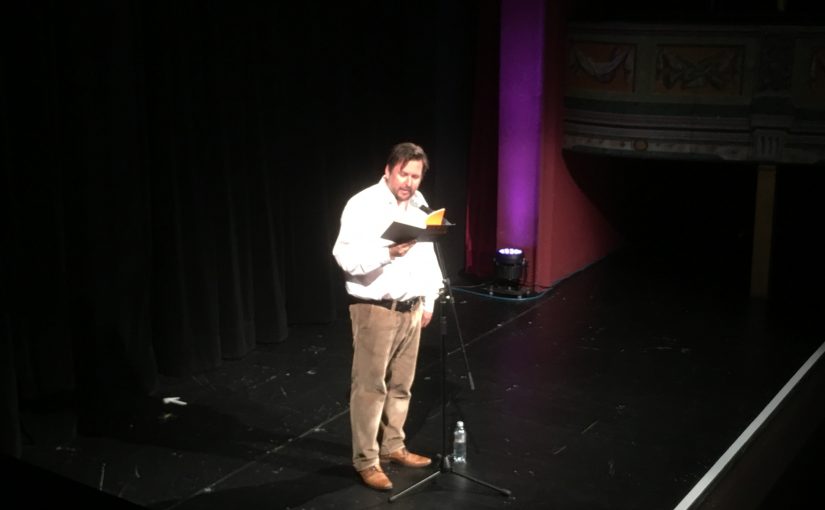C’est sous un soleil tant attendu, au bord de l’Aare, qu’humblement, Rinny Gremaud nous a accordé un entretien pour nous parler des conditions qui ont entouré la rédaction de son premier roman, Un monde en toc. De formation journalistique, elle s’expose avec sincérité et nous avoue les difficultés qu’elle a rencontrées pour passer du format de l’article à celui du roman. Elle nous raconte avec humour l’aventure qui se cache derrière les mots de son dernier roman, incisif, ironique et (trop) vrai, paru en mars 2018 aux éditions du Seuil. C’est un charmant moment d’échange et de convivialité que nous vous proposons dans cet article, à lire muni d’un capuccino.
Mon dernier livre, Un monde en toc, est un projet qui m’est venu en tête à la suite d’un constat : où qu’on aille, Dubaï, Casablanca, Edmonton, Kuala Lumpur, on retrouve les mêmes enseignes commerciales, les mêmes boutiques, on peut même retrouver à des milliers de kilomètres, exactement le même modèle de jeans qu’on a laissé chez soi. Du coup, je me suis interrogée sur ce qui pousse encore les gens à se déplacer ; on peut faire le tour du monde sans vraiment se sentir dépayser, ni percevoir de véritables changements visuels, ce qui crée une sorte d’absurdité du déplacement.
J’ai entrepris ce voyage avec derrière la tête le projet d’en faire un reportage comme le veut ma formation de journaliste. Évidemment, le choix de mes destinations est arbitraire, il a été régi par des contraintes de temps, d’argent, mais aussi, par la volonté de refléter une diversité climatique, économique et culturelle. L’Amérique du Nord a une culture très proche de la nôtre, tandis que pour la Malaisie, par exemple, on se retrouve plongé dans un univers culturel hétérogène, à la fois très influencé par la Chine, tout en ayant une culture musulmane. Quant à Dubaï, il me semblait essentiel d’y faire escale dans le cadre d’une étude de la « génétique commerciale ». Il y a énormément d’autres villes que j’aurais souhaité visiter, comme Mexico, mais comme je l’ai dit, j’ai dû faire des choix en fonction du temps et des moyens que j’avais à ma disposition. J’avais comme critère obligatoire la présence de méga malls, puisque j’espérais pouvoir y passer plusieurs jours sans trop m’y ennuyer. J’ai bien conscience que mes choix ne sont ni fondés ni exhaustifs, et que mon itinéraire de voyage se justifie difficilement sur le plan de la recherche.
Je suis vraiment partie en excursion avec la volonté d’en faire un reportage. Ce n’était pas prémédité que le résultat de mon expérience prenne la forme d’un roman ; c’est le résultat d’une série de hasards et d’échecs aussi. J’étais arrivée à un moment de ma vie de journaliste où j’avais l’ambition de m’essayer à des formats plus grands. Cependant, mes observations tout au long de mon voyage étaient insuffisantes pour remplir les exigences d’un vrai travail d’enquête, je ne me sentais pas de légitimité journalistique. Je tenais quand même à sauver ce projet, et c’est pour cette raison que j’ai opté pour un format qui m’accordait plus de liberté. Enfin, ça c’est une des raisons que j’invoque lorsqu’on me demande pourquoi un roman. A vrai dire, je ne pense pas que le récit de ce voyage-là, sans regard subjectif pour le cadrer, intéresserait grand monde. Le sujet traité s’accommode bien d’une voix personnelle. C’est un travail sur l’ennui, sur la laideur et sur la monotonie du paysage ; si je me cache derrière un regard distant et objectif, le traitement du sujet en devient désagréable et il est probable que personne ne le lise. J’ai ressenti le besoin de m’investir, et de donner au lecteur ce que je voulais qu’il voie.
Toutes les rencontres que j’ai couchées sur papier m’ont marquée, c’est un grand travail de deuil de faire le tri entre ce qui aura sa place dans le roman et ce qui sera laissé de côté. Je fonctionne un peu comme un chasse-neige, je récolte tout ce que je peux, et je fais le tri par la suite. Je ne prends pas de notes pendant le voyage, seulement des mots-clés, illisibles pour quelqu’un d’autre que moi. J’utilise énormément la photographie, mais ce sont de vilaines photos qui ne sont pas destinées à être montrées, elles servent à me rappeler seulement ce que je voulais montrer, mais aussi l’état d’esprit dans lequel j’étais lorsque j’ai pris le cliché. On ne peut pas prévoir ce sur quoi on va tomber ; il y a des rencontres qui ne m’ont servi à rien, et d’autres qui étaient vraiment inattendues et extraordinaires. Il y a des portraits d’entrepreneurs que je n’ai pas fait, de peur qu’ils ressemblent trop à d’autres portraits, je voulais éviter des redites. Aussi, je crois au pouvoir de fiction du monde réel, j’aime le hasard, ne pas savoir ce qu’on va rencontrer sur sa route, comme cette découverte improbable d’une femme qui passait sa vie entière dans les malls. C’était inespéré, on pourrait écrire un livre uniquement sur le vide intersidéral de sa vie. Il y a des récits potentiels partout.
Avec le choix du titre on pourrait s’attendre à une violente critique du système capitaliste, et il donne d’emblée une couleur au livre, une clé de lecture. Ce n’était pas mon intention, je n’avais qu’un titre de travail lorsque je l’ai envoyé à mon éditeur, c’était « Centres commerciaux ». Sa première suggestion lors des premières phases de relecture a été de le renommer « malls ». Puis, dans un troisième temps, il a extrait le titre final d’un passage du livre, du dialogue que j’entretiens avec un touriste chinois dans l’avion. J’ai fait un gros effort pour ne pas avoir un regard surplombant, je ne voulais pas d’un discours dénonciateur et hautain. Ça ne collerait pas avec ce que je suis au fond ; j’ai de l’empathie pour les gens et non pas du mépris, même pour des personnes qui sont à des années-lumière de mes valeurs, je ne ressens pas l’envie de les juger. J’ai consciemment fait en sorte de respecter ce que je voyais et garder une forme d’objectivité. C’est important pour moi de conserver un regard critique non seulement sur ce que je vois, mais sur moi-même aussi, qui suis-je pour juger ? Ensuite, concernant les touristes, on retrouve dans le roman quelques passages où je les juge, notamment à Bangkok, mais dans ce cas-ci je me permets de les juger car ils viennent du même univers culturel que moi, et partagent les mêmes valeurs. Dans le cas des touristes chinois, il y a une barrière culturelle qui m’empêche de tout saisir de leurs coutumes, je dois appliquer un relativisme culturel. La seule exception était Dubaï, je le dis dans mon livre, je n’ai personnellement aucune empathie pour cette ville ni pour ses touristes.
Les décalages horaires étaient violents, les flottements et moments d’apesanteur décrits dans le roman découlent de cet état de fatigue. Ça m’a rappelé ces longs moments d’attentes dans la nuit pendant mon adolescence, ces états de fatigue qu’on a tous déjà connu. J’ai évolué comme l’œil d’une caméra, sans être investie dans la vie des gens que je rencontrais, j’observais simplement leur quotidien sans m’y ancrer. J’avoue qu’une chose que j’aime particulièrement dans le voyage c’est disparaître, m’évincer de ma vie quotidienne, fuir, ne plus avoir à paraître. La vie quotidienne me pèse, dans le sens où il y a sans cesse une tâche dans laquelle s’investir. L’apparence est très pesante aussi, cette espèce de devoir social de conversation. Même si toutes ces choses sont plutôt agréables, je ressens le besoin de m’en échapper parfois. C’était un voyage produit de la fuite, de la mélancolie, un voyage de tradition romantique, qui consiste à se perdre, à mourir un peu.
Je sais désormais qu’un livre ne s’écrit pas d’une traite, j’ai renoncé au fantasme qu’on pouvait plonger dans un projet et voir les pages défiler avec fluidité. Mon voyage date de 2014 et le roman n’est paru qu’en mars 2018 ; ça représente un processus de 4 ans dans son ensemble. La première version écrite est restée en suspens, puis sont venues ma démission et ma grossesse qui s’est avérée très prenante. Pour finir, je n’en pouvais plus de traîner ce livre derrière moi, je suis parvenue à dégager du temps pour le mener à bien. Puis c’était rapide entre le moment où le livre est arrivé dans les mains de l’éditeur et le moment où il l’a publié. Ecrire un livre a été une aventure pour moi, je me retrouve plongée dans un univers qui détonne complétement du monde journalistique auquel je suis habituée. En plus, j’avais l’impression, avant de tenter l’expérience moi-même, que les personnes qui écrivaient des livres avaient un grand égo, qu’il y avait une quête de prestige derrière toute publication. Je me suis rendu compte que si je l’ai fait, c’est surtout pour tenter quelque chose de nouveau. Grâce à mon roman j’ai fait de très belles rencontres et découvertes, j’ai fait des tournées de lectures en Slovaquie, par exemple, dans des classes de filles qui apprennent le français. Au moment où le livre est lu, il prend de la valeur. Me lancer dans le roman aura vraiment été une expérience formidable. Je suis vraiment surprise en bien des nouveaux horizons que j’ai découverts, mais on appuie ses fictions sur des expériences vécues, et pour avoir de la matière à traiter, il faut d’abord oser se sortir de sa zone de confort.
Déborah Badoux