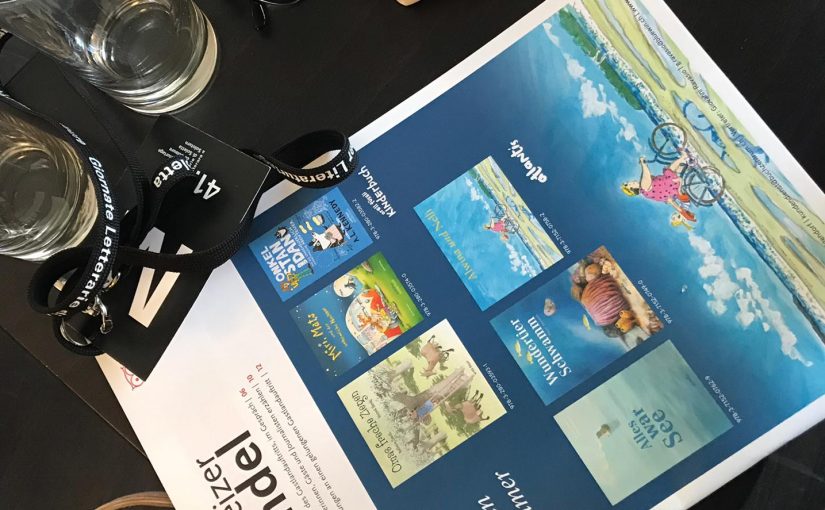Wir schliessen den Blog der Solothurner Literaturtage 2019 hiermit – mit einem besonderen Gruss an die Veranstalterinnen. Wir sehen uns im nächsten Jahr!
Kategorie: Alles / Tous les articles
Ein Gespräch über Bücher
Das zweite Branchengespräch der Literaturtage drehte sich um die Frage, wie aus einem Text ein Buch wird. Als Podiumsgäste waren Annette Beger, die Leiterin des Zürcher Kommode Verlags, und Gabriel de Montmollin, bis 2015 Leiter der Éditions Labor et Fides und mittlerweile Leiter des Musée international de la Réforme in Genf. Geleitet wurde das Gespräch von Dani Landolf, seines Zeichens Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbands SBVV. Landolf verwies auf die Sonderstellung, die dem Schweizer Buchmarkt aus seiner Viersprachigkeit erwächst: Die Verlage in der Westschweiz orientieren sich nach Frankreich, die im Tessin nach Italien und die Deutschschweizer schauen nach Deutschland und Österreich. Dass diese Länder Euroländer sind, hat einen grossen Einfluss auf die Schweizer Verlage, nicht zuletzt seit die Buchpreisbindung 2008 in der Schweiz aufgehoben wurde.

Im deutschsprachigen Bereich der Schweiz gibt es zur Zeit circa 200 Verlage, von denen rund die Hälfte „professionell“ betrieben würden. Thematisch sei die Schweizer Verlagslandschaft breit aufgestellt, fügt Landolf an, dies gälte insbesondere für den Kunst- und Architekturbereich als auch für das Feld der Sach- und Kinderbücher. Auch Wissenschaftsverlage machten ein durchaus herzeigbares Sement aus, wenn sie auch in der Öffentlichkeit nicht sehr präsent seien.
Annette Beger vertiefte sodann das Gebiet der Verlagskalkulation, referierte die prozentualen Anteile, welche sich auf die Buchhandlungen, dem Verlag und den Autor aufteilen, nicht zu vergessen die Kosten für Druck und Distribution. Auf die Frage, wo Verlage denn tatsächlich drucken lassen würden, antwortete Beger, dass der Kommode Verlag in Italien drucken lasse. Dies sei kostengünstiger und trotzdem stimme die Qualität trotzdem. Bücher aus englischen Verlagen fände sie schrecklich, meint Beger, denn diese seien meistens beschichtet, die Beschichtung löse sich nach und nach ab und werde klebrig.
Sodann wurde die Frage diskutiert, wieso es immer noch so wichtig sei, dass die Buchhändler das Recht haben, nicht verkauften Bücher wieder zurück geben zu können. Beger warf ein, dass man bedenken müsse, dass die Buchhandlungen auch Bücher von unbekannten Autoren bestellen und somit immer das Risiko haben, dass die Bücher nicht verkauft werden – was Rolf Lappert, den ersten Gewinner des Schweizer Buchpreises, anmerken liess, dass man ein Buch auch verkaufe, wenn man von ihm überzeugt sei.
Was aber leisten Verlage überhaupt?
Das Podium war sich einig: Sie sind Dienstleister, verwalten die Rechte der Autoren, vertreiben, lektorieren und führen die Promotion für das jeweilige Buch durch. Nicht jeder Autor kann gut lesen, dafür muss man kreative Alternativen entwickeln. Die meiste Zeit nehme das Lektorat ein. Man kann Autoren nur aufbauen, wenn man am Text arbeitet.
Die Frage, ob Autoren Verlage denn auch wirklich als Dienstleister in Anspruch nehmen müssten, bejahte Rolf Lappert. Das Lektorat sei für ihn unglaublich wichtig. Wenn ein Verlag seine Texte zu gut fände und er ein fertiges Manuskript einreiche, welches dann nicht mehr bearbeitet würde, werde er skeptisch. Für ihn sei wichtig, dass das Manuskript richtig überarbeitet werde. Es dürften sich nach einem qualitativen guten Lektorat keine Fehler mehr im fertigen Buch finden. Lappert adressierte dann auch junge AutorInnen der Bieler Schreibschule, deren Manuskripte meist bereits bei Einreichung eine sehr gute Qualität aufwiesen, nicht zuletzt weil sie bereits bei Agenturen überarbeitet worden seien.
Der Austausch gestaltete sich äusserst interessant und eröffnete die Möglichkeit, mehr über die Schweizer Verlagslandschaft zu erfahren. Dani Landolf fragte geschickt nach, blieb hartnäckig, wenn Fragen nicht präzise genug beantwortet wurden und achtete darauf, dass auch die Zuhörer miteingebunden wurden, um deren Französischkenntnisse es nicht so gut bestellt war – wie um die meinen.
#whatislove
Liebe kann man nicht definieren. Aber man kann versuchen, über sie zu reden. Dies hatten sich Gina Bucher, Martin R. Dean und Peter Passett in einer Podiumsdiskussion vorgenommen, die von der Schriftstellerin Gabrielle Alioth moderiert wurde. Die drei geladenen Gäste sollten sich alle mit dem Sujet auskennen: Bucher befragte in ihrem Buch „Ich trug ein grünes Kleid, der Rest war Schicksal“ ältere Menschen zum Thema Liebe. Dean hat vor kurzem seinen Roman „Warum wir zusammen sind“ veröffentlicht, in dem es besonders um die ausgelaugte Liebe bei Ü-40-Paaren geht. Passet ist pensionierter Psychotherapeut/-analytiker und hat deshalb viel Erfahrung und genügend Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was Menschen „im Innersten zusammenhält“ – oder eben nicht.
Doch was ist es nun, dieses Phänomen der Liebe, dieses kuriose Abstraktum? Zunächst einmal ein Paradoxon: Alle haben die Liebe erlebt – oder erleben sie gegenwärtig -, doch niemand kann sie benennen. In der Podiumsdiskussion nähern sich die Teilnehmenden dem Konzept der Liebe, dieser schwummrigen Blase an; sie brechen sie auf einzelne Komponenten herunter, deren Definitionen leichter fallen.
Zentral für den Begriff der Liebe ist zum Beispiel der Sex. Sex sei eine spezifische Form von Lust, die sich biologisch erklären lasse und Lebewesen zuerst einmal zusammenbringe. Wie wichtig ist Sex aber für eine längerfristige Beziehung? Wird Sex überbewertet, und sind wir eine oversexed generation? Laut Bucher müssen wir ständig über Sex reden und Dean findet, Sex werde als notwendig eingestuft in unserer Gesellschaft. Was passiert jedoch im Alter, wenn die sexuelle Lust nach und nach schwindet? Schwindet dann auch die Liebe? Dies sei nicht zwingend der Fall, sagt Passett. Zudem müsse zwischen Sex und Erotik unterschieden werden. Sex ist also nicht alles. Die sexuelle Revolution ’68 sei ausserdem gescheitert, denn – so Passett – wir sind heute „verklemmter als die Viktorianer[Innen]“. Dean widerspricht: Nicht vergessen dürfe man, dass durch ebendiese 68er Revolution sich auch Frauen ihre Sexualität zueigen machen konnten.
Die Diskutierenden sind sich einig, dass Liebe nicht nur biologischer Drang sein kann. Menschen seien eine Spezies – vielleicht die einzige -, bei der die Liebe ein metaphysisches Konzept und nicht der blosse Überlebens- und Fortpflanzungstrieb sei. Wir jagen nicht nur dem schnellen Glück hinterher, sondern haben eine Sehnsucht nach Konstanz und Stabilität in der langanhaltenden Liebe. So ähnlich wie das Gefühl von Heimat.
Die Ehe als traditionelle und institutionalisierte Form der Liebe sei nicht besonders geeignet, um deren Erhalt zu garantieren. Dean sieht die Ehe als utopischen Horizont, demenstsprechend sei sie längerfristig zum Scheitern verurteilt. Während sich die Liebe selbst über die Jahre verändere, bliebe der gesellschaftliche Zwang der Ehe bestehen. Wie ein Käfig hindere die Ehe die Liebe daran, davon zu flattern. Laut Bucher existiere die Liebe bei älteren Ehepaaren daher oft nur noch in Erinnerungen. Erinnerungen, die sehr trügerisch sein können, weil sie Schönes verschönern und Schlimmes verschlimmern. Doch warum sind viele ältere Paare trotz Ausbleiben von Sex und Liebe immer noch zusammen?
Womöglich, weil sie in einer Zeit aufgewachsen sind, nach deren Sebstverständnis man sich – einmal verheiratet – schlichtweg nicht mehr trennte. Man arrangierte sich mit der Situation und redete mit niemandem darüber. Dies sei heute anders: Die Liebe wurde frei und die Ehe-Traditionen wurden durch die Emanzipation gesprengt. Dean zufolge leben wir in einer Multioptions-Gesellschaft. Apps wie Tinder vermarkten die Liebe schnell und grossflächig. Das Potential dieser neuen Liebe ist jedoch zugleich deren Schwäche: Weil wir uns nicht mehr festlegen müssen, können wir es nicht mehr. Fazit: Die Liebe war und ist also kompliziert und wird es vermutlich auch bleiben. Die Antwort auf die Frage, warum wir zusammen sind, müssen wir selbst finden.
Alioth entlässt uns in die Freiheit mit einem durchaus treffenden Zitat, das ausgerechnet von Augustinus stammt: Dilige et quo vis fac. Uralt und gleichzeitig hochaktuell. Genauso wie die Liebe selbst.
„Es ist schwierig, sich mit historischen Romanen zu behaupten“
Gabrielle Alioth erscheint – trotz meiner sehr kurzfristigen Anfrage – gut gelaunt und aufgeweckt im Café Solheure. Ich freue mich auf unser Gespräch. Mein Interesse gilt ihrem jüngsten Roman Gallus, der Fremde, der den rätselhaften Lebensweg des Wandermönches Gallus neu erzählt. Das Leben von Gallus verbindet sich im Roman mit jenem einer Ich-Erzählerin, die am Ende des 20. Jahrhunderts den umgekehrten Weg geht: von der Schweiz nach Irland (genauso wie Gabrielle Alioth selber). Als Zeitreisende besucht die Ich-Erzählerin Gallus und befragt ihn zu seinem Leben. Es scheint, als wolle sie das Leben des Heiligen ergründen, um etwas über ihr eigenes zu lernen. Der Roman ist ein Oszillieren zwischen verschiedenen Erzählperspektiven und Zeiten. Gedankenstränge verbinden sich zu einem Gemisch an Erinnerungen. Mit Gabrielle Alioth habe ich über ihren unkonventionellen historischen Roman gesprochen. Ich bin der Frage nachgehen, welchen Stellenwert der historische Roman heute noch hat und war erstaunt, dass es Gabrielle Alioth selber nicht immer gefällt, wenn ihre Romane das „Label“ des historischen Romans erhalten.
Gabrielle Alioth, zuerst einmal: Wie ist Gallus, der Fremde bei den Leser*innen angekommen? So wie erhofft?
G. Alioth: (lacht) Sogar besser als erhofft. Ich hatte schon Bedenken. Mein grosser Vorteil ist, dass Gallus in der Ostschweiz stark verwurzelt ist. Die Ostschweizer interessieren sich einfach für Gallus. Es gab Diskussionen, viele interessante Rückmeldungen und ein grosses Interesse an Lesungen.
Du sprichst von Bedenken. Einige Zweifel am Vorhaben, etwas über Gallus zu erfahren, lassen sich auch während der Lektüre feststellen. So beispielsweise in den Überlegungen der Ich-Erzählerin selber.
G. Alioth: Ich konnte mir bis zum Schluss nicht ganz erklären, was mich an der Geschichte vom grantigen Heiligen in seiner modrigen Einsiedelei wirklich interessiert. Es ist ja eigentlich schon ziemlich „unsexy“. Ich habe grosses Glück mit meinem Verlag. Normalerweise wäre es schwierig, einem Verlag eine solche Geschichte schmackhaft zu machen. Ein anderer Verlag hätte vielleicht gesagt: Da gibt es keinen Sex und keinen Mord. Was willst du eigentlich?
Was hat dich denn an Gallus fasziniert?
G. Alioth: Mich fasziniert, wenn eine Autorin, ein Autor oder ein Leben gradlinig ist. Wenn jemand konsequent seinen Weg verfolgt. Das tat Gallus auf jeden Fall. Deswegen schrieb ich immer weiter. Aber ich habe während dieser fünf Jahre nicht kontinuierlich am Roman gearbeitet. Ich musste das Ganze wachsen lassen. Ich musste Gallus zuerst kennenlernen. Es gibt ja dieses Klischee: Da ist der Punkt, an dem du vielleicht 60 Prozent des Romans geschrieben hast. Dann erst kennst du die Figuren richtig. Von da an läuft es rasch. Bis dahin aber gilt: „rewrite, rewrite, rewrite“, bis die Person in sich stimmig ist. Was mich an Gallus fasziniert, ist seine Widerborstigkeit.
Vieles hast du offengelassen. Gehören diese Leerstellen für dich zum historischen Roman dazu?
G. Alioth: Ja, das ist meine Vorstellung von einem historischen Roman. Wir können uns nicht vorstellen, wie die Menschen damals gelebt haben. Wir können uns ja schon nicht mehr vorstellen, wie wir uns vor 20 Jahren gefühlt haben. Ich muss immer offenlegen, was möglich ist. Und zwar ohne zu sagen: So ist es! Die Konstruktion der Erzählebenen mit der Ich-Erzählerin hat mir dabei geholfen, alles zu hinterfragen.
Historische Romane kommen oft etwas kitschig daher. Kannst du bei der Gestaltung und Vermarktung deiner Romane mitreden?
G. Alioth: Nur sehr beschränkt. Beim Hardcover noch eher. Aber wenn dann die Taschenbuchrechte verkauft werden, was ja eigentlich schön ist, denke ich mir dann manchmal: Nein, wie kommt das jetzt daher? Es ist schwierig, sich mit historischen Romanen zu behaupten. Das sehe ich auch jetzt an den Solothurner Literaturtagen, wo wir nur ganz wenige historische Romane haben. Da ist natürlich Lukas Hartmann mit seinem wunderbaren Roman „Der Sänger“, aber auch er ist eher eine Ausnahme.
Wie siehst du den Stellenwert des historischen Romans momentan?
G. Alioth: Es ist schwierig. Ich habe auch andere Romane geschrieben, die ebenfalls als „historische Romane“ betitelt wurden. Es wurde ein wenig zu einem „Label“, mit welchem ich mich nicht ganz wohlfühle. Einige Menschen denken bei „historischen Romanen“ an diese Billigromane. Und mit diesen lässt man sich natürlich nicht gerne ins gleiche Regal stellen. Andererseits ist der historische Roman eine einzigartige Chance, der Gegenwart einen Spiegel vorzuhalten.
Im weiteren Verlauf des Gespräches habe ich mich mit Gabrielle Alioth darüber unterhalten, inwiefern der historische Roman im englischsprachigen Raum einen anderen Stellenwert einnimmt, als im deutschsprachigen – und nach den Gründen dafür gefragt. Gabrielle Alioth hat mir des weiteren erklärt, was die Erzählebenen in Gallus, der Fremde mit einer keltischen, bisweilen romantischen Vorstellung von Zeit und Ort zu tun haben. Gabrielle Alioth hat mir auch verraten, weshalb sie selber beim Schreiben nach wie vor den historischen Roman gegenüber den Romanen bevorzuge, welche in der Gegenwart oder der Zukunft angesiedelt sind.
Das ausführliche Interview mit Gabrielle Alioth erscheint in Kürze auf der Buchjahr-Seite. Seid gespannt!
Ihr dürft schon ein bisschen näher kommen
Niemand getraut sich so richtig, die erste Sitzreihe direkt am grossen Tisch in Beschlag zu nehmen, an dessen Kopfende bereits Donat Blum, Anna Stern, Ivona Brđanović, Lou Meili, Martin Frank und Lino Sibillano sitzen.
«Ihr dürft schon ein bisschen näher kommen», sagt darum Donat Blum, und alle Besucher*innen rücken eine Reihe nach vorn, sodass jetzt auch die Stühle direkt am Tisch besetzt sind und die Autor*innen mit dem Publikum im Kreis sitzen.
Dem Publikum Autor*innen und ihre gemeinsamen Arbeit an einem Text näher zu bringen, ist das Ziel der Veranstaltungsreihe «Skriptor». Das Format soll einen Begegnungsort schaffen, sagt Donat Blum, der «Skriptor» ins Leben gerufen hat, den literarischen Schaffensprozess für Leser*innen sichtbar machen.
Heute sitzen Autor*innen von «Glitter*», dem ersten und einzigen Magazin für queere Literatur im deutschsprachigen Raum, in der Runde. Besprochen wird ein Text von Lino Sibillano. Er nennt den Auszug eine «Baustelle, einen Anfang von Etwas».
Sibillano liest seinen Text vor, die Autor*innen und Besucher*innen hören zu, verfolgen die Zeilen mit den Augen oder lauschen einfach der Stimme des Autors. Dann eröffnet Donat Blum die Diskussion. Wer jetzt erwartet hat, die Autor*innen würden nach dem Prinzip «zuerst drei positive Punkte, dann Kritik» vorgehen, wird überrascht.
Die Kritik kommt ohne Umschweife, ist ehrlich, präzise, zielt auf Inhaltliches, aber auch Sprachliches. Dabei sind die Autor*innen nicht immer gleicher Meinung. Uneinigkeit entsteht etwa um die Wahl eines Wortes, das auf «-chen» endet. Während sich Donat Blum fragt, was das hier zu suchen habe, sieht Lou Meili darin eine gekonnte Charakterisierung des Erzählers.
Man merkt, wie genau sich die Autor*innen in den Text hineingedacht haben. Hier soll die beste Form eines Textes aus dem Sprachmaterial herausgeschält werden. Dann darf sich auch das Publikum zum Text äussern, auch hier werden genaue Beobachtungen beschrieben. Lino Sibillano hört aufmerksam zu, macht sich Notizen, nimmt auch die direkteste Kritik mit einem Lächeln zur Kenntnis, etwa als Ivona Brđanović eine Textstelle als «Coelho-Moment» bezeichnet.
Zum Schluss sind sich aber alle einig, die Autor*innen und das Publikum: Sibillanos Text hat Potential, einen spannenden Ansatz, der verschiedene Textsorten vereint und mit fiktionalen Ebenen spielt. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich sein fertiger Text lesen wird.
„Traut euch und probiert aus“ – Autorengespräch mit Tabea Steiner
Tabea Steiner hat an den Solothurner Literaturtagen ihr Erstlingswerk „Balg“ gelesen. In den vergangenen Jahren hat sie selbst viele Literaturfestivals organisiert und sogar initiiert. Am heissen Sonntagnachmittag hat sie sich viel Zeit für meine Fragen genommen.
Du warst das erste Mal als Autorin am Literaturfestival dabei, vorher hast du Festivals organisiert und initiiert. Wie war der Perspektivenwechsel für dich?
Sehr schön. Als Organisatorin stehe ich stetig unter Strom, was hier zwar auch der Fall ist, aber die Verantwortung ist nicht so gross. Als Organisatorin nehme ich jede Kritik und jeden Zwischenfall sofort wahr und auf. Dadurch, dass ich beide Seiten kenne, schätze ich die Arbeit der Organisatoren und Organisatorinnen hier sehr und weiss die kleinen Details zu schätzen. Das Publikum in Solothurn ist sehr wohlwollend, das ist unglaublich schön.
Wir, die hier am Blog arbeiten, studieren alle Germanistik. Ich wage zu behaupten, dass alle Germanistikstudentinnen und -studenten irgendwie den Wunsch hegen, ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Hattest du diesen Wunsch schon immer, ein eigenes Buch zu schreiben?
Der Wunsch war schon immer da. Es war sogar der Grund, weshalb ich Germanistik studieren wollte. Ich wollte mehr wissen, mich auskennen und austauschen. Ich habe dann im Studium schnell gemerkt, dass Germanistik und literarisches Schreiben nicht viel miteinander zu tun haben. Das Studium hat mir dennoch viel gebracht und mein analytisches Denken weiterentwickelt. Kurz nach Beginn meines Studiums wurde das Literaturinstitut in Biel eröffnet. Ich habe kurz überlegt, mich dort zu bewerben, habe mich aber schlussendlich dagegen entschieden und mein Germanistikstudium beendet. Darüber bin ich im Nachhinein auch froh. Ich glaube aber, dass die Leute, die am Literaturinstitut waren, es einfacher haben, ein Selbstverständnis als Autor oder Autorin zu entwickeln. Das Aufnahmeverfahren mit einzuschickenden Texten legitimiert die Bewerberinnen und Bewerber bereits. Ansonsten muss man sich gewissermassen selber dazu befähigen oder ernennen. Ich habe früher immer gesagt, dass ich schreibe, also: dass ich Autorin bin. Seit ich das Buch zum ersten Mal in den Händen hatte, sage ich, dass ich Schriftstellerin bin. Ich finde, dass das ein schöner Begriff ist. Dazu beigetragen hat sicher, dass ich ein Stipendium am LCB bekommen habe, was für mich extrem wichtig war.
Du hast von dem Moment gesprochen, in dem du das Buch das erste Mal in den Händen hattest. Wie lange hat der Prozess gedauert, bis du das Buch das erste Mal in den Händen hattest?
Ziemlich genau sechs Jahre.
War es eine bewusste Entscheidung, in deinem Roman keine Kapiteleinteilungen zu machen, sondern nur Absätze als Marker für Fokalisierungswechsel?
Die Entscheidung fiel, als Timon (Anm.d.Red.: der Protagonist des Textes) dazugekommen ist. Da verspürte ich den Wunsch, alle zur Sprache kommen und ihre eigene Perspektive erläutern zu lassen. So hat sich die Frage nach den Kapiteln eigentlich erledigt. Nicht zuletzt konnte ich damit Timons Entwicklung aufzeigen. Kapitel wären unnötige Brüche gewesen. Es gibt ja immer noch die Absätze. Anfangs wollte ich nach jedem Absatz eine neue Seite beginnen, aber so konnte ich die unterschiedliche Perspektivierung auf das gleiche Geschehen besser darstellen. Ich habe mich da sehr am Film orientiert.
Valentin ist der Postbote im Dorf. Postboten bringen normalerweise eine Botschaft. Welche Botschaft übermittelt Valentin?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, seine Botschaft bestünde in der Bereitschaft, Haltungen zu überdenken, sie sogar zu ändern. Für mich ist er als Briefträger (und auch als Lehrer) vor allem wichtig, da er extrem viel weiss, alle kennt, die Mechanismen versteht und gleichzeitig ein Aussenseiter ist.
Dein erstes Buch ist jetzt abgeschlossen. Hast du schon neue Projekte geplant, von denen du erzählen kannst?
Ich habe bereits vor etwas mehr als einem Jahr mit einem neuen Projekt begonnen. Die Idee hatte ich schon länger und ich arbeite momentan vor allem daran. Ich freue mich besonders auf diesen Sommer, wo ich im Rahmen eines Stipendiums für drei Monate am LCB schreiben darf und mich ganz auf dieses Projekt konzentrieren kann. Gerade um Figuren entwickeln zu können, tut mir so eine intensive Schreibphase sehr gut. Das Thema des neuen Projektes hat sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun, das ist schwierig. Zunächst habe ich begonnen, über eine Figur in der dritten Person zu schreiben. Das hat sich aber noch zu sehr nach mir selbst angefühlt. Dann habe ich es mit der Ich-Perspektive versucht. So konnte ich mich in eine Figur versetzen, die ich mir ausgedacht habe, die aber nicht mehr ich bin. Viele Charakterzüge der Figur kenne ich, dennoch bin ich es nicht. Das war für mich ein sehr spannender Effekt.
Merkst du eine Veränderung deines Stils bei verschiedenen Projekten?
Ich denke ja, ich hoffe es jedenfalls. Die Figuren sind völlig verschieden mit unterschiedlichen Geschichten. Das sollte sich meiner Meinung nach auch in der Sprache niederschlagen. Ich denke, dass Themen sich ihre Formen nehmen. In meinem neuen Projekt gibt es nur einen Perspektivenwechsel. Der Rest wird aus der Perspektive einer Figur erzählt, in einem Schwall sozusagen. Aber es ist ähnlich szenisch aufgebaut. Schon bei Balg hatte ich je nach Perspektive andere Schreibstile. Grundsätzlich habe ich meinen Stil, der sich zwar stetig weiterentwickelt, sich aber nie völlig verändert.
Philipp Theisohn meinte, ich muss dich unbedingt nach Erika Burkart fragen…
(Lacht) Aha. Also, Erika wurde 1922 geboren und ist 2006 gestorben. Sie würde also bald 100 Jahre alt werden. Sie war Lyrikerin und hat sich stark mit der Natur befasst, hat aber auch Romane geschrieben. Ich finde, dass sie eine sehr spannende Position hat. Zudem wurde mit ihr etwas ganz Seltsames gemacht. Sie hatte lange, blonde Locken, später lange, weisse Locken, sah immer etwas unterdrückt aus. Sie war damit das Bild der Lyrikerin, was sich auch sehr stark auf ihre Rezeption niedergeschlagen hat. Jetzt ist sie in Vergessenheit geraten. Mein Text von gestern Abend (a.d.R. Tabea Steiner las am Samstag Abend im Rahmen des Festivals einen Text zum Thema „Alte Meisterinnen“) sagt eigentlich aus, dass man sie wieder mehr beachten sollte, ihre Texte hervornehmen und genau anschauen. Sie war für mich immer die Lyrikerin der Schweiz. Ich habe sie einmal zum Literaturfestival in Thun eingeladen, da war sie aber leider krank und eingeschneit. Sie wird oft als Mythische, sehr esoterisch beschrieben, schrieb viel Übersinnliches und nahm dies auch sehr ernst, war aber eine unglaublich wache, klare Zeitgenossin mit klaren politischen Zügen. Sie geht zum einen vergessen, wird aber auch extrem verniedlicht. Ich finde, Philipp Theisohn sollte zu ihr ein Symposium an der Uni Zürich veranstalten.
Möchtest du zum Abschluss noch etwas erzählen oder sagen?
Ja, du hast ja gesagt, dass es viele Germanistikstudentinnen und -studenten gibt, die schreiben möchten. Die will ich ermuntern. Denkt euch weg vom Studium und probiert es aus. Die Theorie aus dem Studium könnt ihr dann beim Überarbeiten wieder nutzen. Der Schreibprozess dauert, sechs Jahre in meinem Fall sind lang, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ich würde mich freuen, in einigen Jahren Bücher von euch zu lesen.
Soletta: luogo ameno e letterario
La 41esima edizione delle Giornate Letterarie di Soletta, svoltasi da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, ha proposto un programma di grande varietà, sia linguistica, sia tematica: quattro lingue (francese, italiano, tedesco, romancio) e temi che spaziano dalla letteratura alla cultura, dalla geografia alla politica, dalla storia all’attualità… Più di settanta autori e autrici come protagonisti, un pubblico gremito come co-protagonista e un’ospite d’eccezione: la Natura. Tre giorni illuminati dai raggi del sole e dalla vivacità degli incontri letterari.
Seduta in riva all’Aar, con il sole che si rifletteva sul mio taccuino, rare brezze di vento che alzavano i ciuffi ribelli dei miei capelli, il mio sguardo si è posato su dei piccoli fiori gialli che cercavano di farsi breccia tra le righe del cemento. Mi sono così ritrovata a riflettere sul fatto che nella Natura ci sono i segni e l’idea di resistenza, poiché, nonostante tutto, essa continua ad esserci e a manifestarsi. L’idea di resistenza c’è anche nelle parole – io credo – anche nelle riflessioni fatte e ascoltate degli autori e autrici delle Giornate Letterarie di Soletta. Così come i nostri piedi lasciano impronte nella Natura, anche le nostre parole lasciano tracce nello spazio e per questo anche le riflessioni, di tutti e di tutte, hanno lasciato segni a Soletta.
 Il rapporto tra essere umano e Natura, nel bene o nel male, cambia con il tempo, e lo stesso vale per le definizioni o le etichette, letterarie e non. Ormai lo sappiamo, quando si agitano questioni di linguaggio c’è qualche sommovimento sociale in atto. Sintonizzandoci sulla frequenza del nostro presente, ci è facile percepire che stiamo vivendo in un’epoca di cambiamenti sociali. E nella nostra società la capacità più difficile ma fondamentale da acquisire è proprio quella di osservare: saper vedere la Natura, o meglio, tutto ciò che ci circonda. Ma non basta solo vedere, bisogna anche saper guardare e, ancora, bisogna saper scegliere dove indirizzare lo sguardo. L’atto stesso di scrivere richiede la capacità di saper fare una scelta, una selezione di quanto visto, di saper decidere cosa raccontare e cosa no. La scrittura, infatti, muove il nostro sguardo e la penna veicola le immagini viste.
Il rapporto tra essere umano e Natura, nel bene o nel male, cambia con il tempo, e lo stesso vale per le definizioni o le etichette, letterarie e non. Ormai lo sappiamo, quando si agitano questioni di linguaggio c’è qualche sommovimento sociale in atto. Sintonizzandoci sulla frequenza del nostro presente, ci è facile percepire che stiamo vivendo in un’epoca di cambiamenti sociali. E nella nostra società la capacità più difficile ma fondamentale da acquisire è proprio quella di osservare: saper vedere la Natura, o meglio, tutto ciò che ci circonda. Ma non basta solo vedere, bisogna anche saper guardare e, ancora, bisogna saper scegliere dove indirizzare lo sguardo. L’atto stesso di scrivere richiede la capacità di saper fare una scelta, una selezione di quanto visto, di saper decidere cosa raccontare e cosa no. La scrittura, infatti, muove il nostro sguardo e la penna veicola le immagini viste.
Partecipare alle Giornate Letterarie di Soletta è stata per me un’esperienza meravigliosa e ci tengo a ringraziare l’Università di Zurigo, in particolare Cristoph Steier e Philipp Theisohn, professori presso il Deutsches Seminar, e Tatiana Crivelli, professoressa presso il Romanisches Seminar, per avermi dato la possibilità di partecipare attivamente a questo evento letterario.
Concludo, condividendo un desiderio (o una promessa): tornare a Soletta e partecipare alla 42esima edizione!
Der Meister hat nichts über Bomben zu berichten
Das Thermometer klettert beinahe auf 30 Grad, die Aare fliesst verlockend durch Solothurn. Eine Abkühlung im Fluss wäre eigentlich ganz schön. Aber es geht auch anders: „Sprache ist wie eine frische Brise“, begrüsst Beat Mazenauer das Publikum am Sonntagnachmittag. Er überlasse nun lieber „dem Meister“ das Wort. Sodann tritt Gerhard Meister ans Mikrophon – begleitet von einigen pflichtschuldigen Lachern.
Der Spoken-Word-Künstler berichtet in sympathischem Berndeutsch von Erfahrungen mit Self-Scan-Automaten, einem Termin bei der Berufsberatung – Astronaut war der einzige Beruf, der passte – oder darüber, wie Engel den lieben Gott beobachteten, wie dieser auf den Wald „abägschnudderät“ habe.
Eines ist klar: Die Texte aus „Mau öppis ohni Bombe“ sind alle bühnentauglich. Und sehr angenehm anzuhören. Selbst bei fast 30 Grad. Bei einem Gespräch zwischen Meister und Mazenauer erfährt das Publikum, dass in Meisters Texten durchaus „kreuzbrave, biedere Begebenheiten“ zu finden seien. Auf die Frage, weshalb er den Dialekt als Ausdrucksform gewählt habe, erzählt Meister, dass er sich mit hochdeutschen Texten auf der Bühne gehemmter fühle. Das sei wahrscheinlich der Grund.
Weshalb aber hat Gerhard Meister nichts über Bomben zu berichten? Diese Frage stellt Beat Mazenauer dem Spoken-Word-Künstler nicht. Die Antwort hätte mich brennend interessiert. Immerhin hält sich Gerhard Meister beim Auftritt genau an sein Versprechen: „Mau öppis ohni Bombe“. Die Bombe kommt in der Spoken-Word-Aufführung tatsächlich nicht vor. Und noch beim Verlassen des Kinos im Uferbau blicke ich gedankenversunken zur Aare und frage mich, was es denn mit den Bomben auf sich hat.
Le temps d’un café avec Rinny Gremaud
C’est sous un soleil tant attendu, au bord de l’Aare, qu’humblement, Rinny Gremaud nous a accordé un entretien pour nous parler des conditions qui ont entouré la rédaction de son premier roman, Un monde en toc. De formation journalistique, elle s’expose avec sincérité et nous avoue les difficultés qu’elle a rencontrées pour passer du format de l’article à celui du roman. Elle nous raconte avec humour l’aventure qui se cache derrière les mots de son dernier roman, incisif, ironique et (trop) vrai, paru en mars 2018 aux éditions du Seuil. C’est un charmant moment d’échange et de convivialité que nous vous proposons dans cet article, à lire muni d’un capuccino.
Mon dernier livre, Un monde en toc, est un projet qui m’est venu en tête à la suite d’un constat : où qu’on aille, Dubaï, Casablanca, Edmonton, Kuala Lumpur, on retrouve les mêmes enseignes commerciales, les mêmes boutiques, on peut même retrouver à des milliers de kilomètres, exactement le même modèle de jeans qu’on a laissé chez soi. Du coup, je me suis interrogée sur ce qui pousse encore les gens à se déplacer ; on peut faire le tour du monde sans vraiment se sentir dépayser, ni percevoir de véritables changements visuels, ce qui crée une sorte d’absurdité du déplacement.
J’ai entrepris ce voyage avec derrière la tête le projet d’en faire un reportage comme le veut ma formation de journaliste. Évidemment, le choix de mes destinations est arbitraire, il a été régi par des contraintes de temps, d’argent, mais aussi, par la volonté de refléter une diversité climatique, économique et culturelle. L’Amérique du Nord a une culture très proche de la nôtre, tandis que pour la Malaisie, par exemple, on se retrouve plongé dans un univers culturel hétérogène, à la fois très influencé par la Chine, tout en ayant une culture musulmane. Quant à Dubaï, il me semblait essentiel d’y faire escale dans le cadre d’une étude de la « génétique commerciale ». Il y a énormément d’autres villes que j’aurais souhaité visiter, comme Mexico, mais comme je l’ai dit, j’ai dû faire des choix en fonction du temps et des moyens que j’avais à ma disposition. J’avais comme critère obligatoire la présence de méga malls, puisque j’espérais pouvoir y passer plusieurs jours sans trop m’y ennuyer. J’ai bien conscience que mes choix ne sont ni fondés ni exhaustifs, et que mon itinéraire de voyage se justifie difficilement sur le plan de la recherche.
Je suis vraiment partie en excursion avec la volonté d’en faire un reportage. Ce n’était pas prémédité que le résultat de mon expérience prenne la forme d’un roman ; c’est le résultat d’une série de hasards et d’échecs aussi. J’étais arrivée à un moment de ma vie de journaliste où j’avais l’ambition de m’essayer à des formats plus grands. Cependant, mes observations tout au long de mon voyage étaient insuffisantes pour remplir les exigences d’un vrai travail d’enquête, je ne me sentais pas de légitimité journalistique. Je tenais quand même à sauver ce projet, et c’est pour cette raison que j’ai opté pour un format qui m’accordait plus de liberté. Enfin, ça c’est une des raisons que j’invoque lorsqu’on me demande pourquoi un roman. A vrai dire, je ne pense pas que le récit de ce voyage-là, sans regard subjectif pour le cadrer, intéresserait grand monde. Le sujet traité s’accommode bien d’une voix personnelle. C’est un travail sur l’ennui, sur la laideur et sur la monotonie du paysage ; si je me cache derrière un regard distant et objectif, le traitement du sujet en devient désagréable et il est probable que personne ne le lise. J’ai ressenti le besoin de m’investir, et de donner au lecteur ce que je voulais qu’il voie.
Toutes les rencontres que j’ai couchées sur papier m’ont marquée, c’est un grand travail de deuil de faire le tri entre ce qui aura sa place dans le roman et ce qui sera laissé de côté. Je fonctionne un peu comme un chasse-neige, je récolte tout ce que je peux, et je fais le tri par la suite. Je ne prends pas de notes pendant le voyage, seulement des mots-clés, illisibles pour quelqu’un d’autre que moi. J’utilise énormément la photographie, mais ce sont de vilaines photos qui ne sont pas destinées à être montrées, elles servent à me rappeler seulement ce que je voulais montrer, mais aussi l’état d’esprit dans lequel j’étais lorsque j’ai pris le cliché. On ne peut pas prévoir ce sur quoi on va tomber ; il y a des rencontres qui ne m’ont servi à rien, et d’autres qui étaient vraiment inattendues et extraordinaires. Il y a des portraits d’entrepreneurs que je n’ai pas fait, de peur qu’ils ressemblent trop à d’autres portraits, je voulais éviter des redites. Aussi, je crois au pouvoir de fiction du monde réel, j’aime le hasard, ne pas savoir ce qu’on va rencontrer sur sa route, comme cette découverte improbable d’une femme qui passait sa vie entière dans les malls. C’était inespéré, on pourrait écrire un livre uniquement sur le vide intersidéral de sa vie. Il y a des récits potentiels partout.
Avec le choix du titre on pourrait s’attendre à une violente critique du système capitaliste, et il donne d’emblée une couleur au livre, une clé de lecture. Ce n’était pas mon intention, je n’avais qu’un titre de travail lorsque je l’ai envoyé à mon éditeur, c’était « Centres commerciaux ». Sa première suggestion lors des premières phases de relecture a été de le renommer « malls ». Puis, dans un troisième temps, il a extrait le titre final d’un passage du livre, du dialogue que j’entretiens avec un touriste chinois dans l’avion. J’ai fait un gros effort pour ne pas avoir un regard surplombant, je ne voulais pas d’un discours dénonciateur et hautain. Ça ne collerait pas avec ce que je suis au fond ; j’ai de l’empathie pour les gens et non pas du mépris, même pour des personnes qui sont à des années-lumière de mes valeurs, je ne ressens pas l’envie de les juger. J’ai consciemment fait en sorte de respecter ce que je voyais et garder une forme d’objectivité. C’est important pour moi de conserver un regard critique non seulement sur ce que je vois, mais sur moi-même aussi, qui suis-je pour juger ? Ensuite, concernant les touristes, on retrouve dans le roman quelques passages où je les juge, notamment à Bangkok, mais dans ce cas-ci je me permets de les juger car ils viennent du même univers culturel que moi, et partagent les mêmes valeurs. Dans le cas des touristes chinois, il y a une barrière culturelle qui m’empêche de tout saisir de leurs coutumes, je dois appliquer un relativisme culturel. La seule exception était Dubaï, je le dis dans mon livre, je n’ai personnellement aucune empathie pour cette ville ni pour ses touristes.
Les décalages horaires étaient violents, les flottements et moments d’apesanteur décrits dans le roman découlent de cet état de fatigue. Ça m’a rappelé ces longs moments d’attentes dans la nuit pendant mon adolescence, ces états de fatigue qu’on a tous déjà connu. J’ai évolué comme l’œil d’une caméra, sans être investie dans la vie des gens que je rencontrais, j’observais simplement leur quotidien sans m’y ancrer. J’avoue qu’une chose que j’aime particulièrement dans le voyage c’est disparaître, m’évincer de ma vie quotidienne, fuir, ne plus avoir à paraître. La vie quotidienne me pèse, dans le sens où il y a sans cesse une tâche dans laquelle s’investir. L’apparence est très pesante aussi, cette espèce de devoir social de conversation. Même si toutes ces choses sont plutôt agréables, je ressens le besoin de m’en échapper parfois. C’était un voyage produit de la fuite, de la mélancolie, un voyage de tradition romantique, qui consiste à se perdre, à mourir un peu.
Je sais désormais qu’un livre ne s’écrit pas d’une traite, j’ai renoncé au fantasme qu’on pouvait plonger dans un projet et voir les pages défiler avec fluidité. Mon voyage date de 2014 et le roman n’est paru qu’en mars 2018 ; ça représente un processus de 4 ans dans son ensemble. La première version écrite est restée en suspens, puis sont venues ma démission et ma grossesse qui s’est avérée très prenante. Pour finir, je n’en pouvais plus de traîner ce livre derrière moi, je suis parvenue à dégager du temps pour le mener à bien. Puis c’était rapide entre le moment où le livre est arrivé dans les mains de l’éditeur et le moment où il l’a publié. Ecrire un livre a été une aventure pour moi, je me retrouve plongée dans un univers qui détonne complétement du monde journalistique auquel je suis habituée. En plus, j’avais l’impression, avant de tenter l’expérience moi-même, que les personnes qui écrivaient des livres avaient un grand égo, qu’il y avait une quête de prestige derrière toute publication. Je me suis rendu compte que si je l’ai fait, c’est surtout pour tenter quelque chose de nouveau. Grâce à mon roman j’ai fait de très belles rencontres et découvertes, j’ai fait des tournées de lectures en Slovaquie, par exemple, dans des classes de filles qui apprennent le français. Au moment où le livre est lu, il prend de la valeur. Me lancer dans le roman aura vraiment été une expérience formidable. Je suis vraiment surprise en bien des nouveaux horizons que j’ai découverts, mais on appuie ses fictions sur des expériences vécues, et pour avoir de la matière à traiter, il faut d’abord oser se sortir de sa zone de confort.
Déborah Badoux
F wie Familie
Die ersten Tage im Kindergarten überstehen, sich nach der Schule mit Freunden verabreden, der Fragerei der Verwandten beim jährlichen Treffen mit diplomatischen Fragen ausweichen – Aufwachsen ist nicht leicht.
Im Literaturgespräch von Tabea Steiner und Rolf Hermann dreht sich alles ums Thema Familie, Erziehung und Erwachsen werden. Dazu haben die beiden Autoren reichlich zu sagen – hoffentlich auch, wo sich die Romane der beiden, Balg beziehungsweise Flüchtiges Zuhause, mit eben dieser Thematik auseinandersetzen.
„Die Menge macht´s nicht aus, sondern, dass es schön wird“, meint der Moderator am späten Sonntagnachmittag in die schmale Runde, die sich in der Säulenhalle zusammengefunden hat.
Schnell kristallisiert sich die leitende Frage der Diskussion heraus. Wie definiert sich Familie? Die verschiedensten Theorien werden daraufhin angerissen: Blutsverwandtschaft, gemeinsame Erlebnisse, Familienmythen und Geheimnisse, Rituale. Und wie konzipiert sich eine literarische Familie?
Als Grundlage dient je eine Passage aus den Texten von Tabea Steiner und Rolf Hermann. Während die fiktive Familie in Steiners Roman durch Zerrüttung strukturiert ist und den spärlichen Zusammenhalt in ebendieser Zerrüttung findet, basiert Hermanns Roman auf Anekdoten der eigenen liebevollen Familiengeschichte. Leider misslingt es dem Gespräch, eine gemeinsame Basis für eine interessante Diskussion zu finden und die 45 Minuten enden ohne eine Verknüpfung von Fiktion und Realität.
Dennoch zeigt sich das Publikum äusserst zufrieden und lobt in der anschliessenden Fragerunde den Einblick in die Werke.