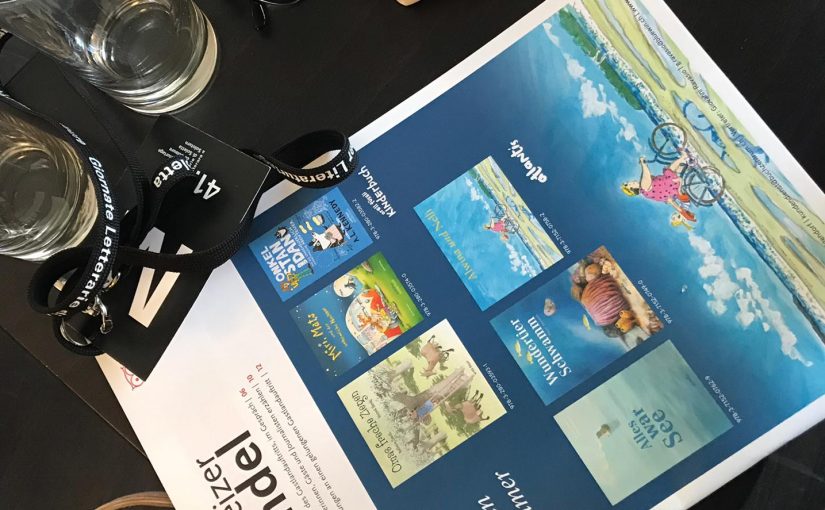Das zweite Branchengespräch der Literaturtage drehte sich um die Frage, wie aus einem Text ein Buch wird. Als Podiumsgäste waren Annette Beger, die Leiterin des Zürcher Kommode Verlags, und Gabriel de Montmollin, bis 2015 Leiter der Éditions Labor et Fides und mittlerweile Leiter des Musée international de la Réforme in Genf. Geleitet wurde das Gespräch von Dani Landolf, seines Zeichens Geschäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbands SBVV. Landolf verwies auf die Sonderstellung, die dem Schweizer Buchmarkt aus seiner Viersprachigkeit erwächst: Die Verlage in der Westschweiz orientieren sich nach Frankreich, die im Tessin nach Italien und die Deutschschweizer schauen nach Deutschland und Österreich. Dass diese Länder Euroländer sind, hat einen grossen Einfluss auf die Schweizer Verlage, nicht zuletzt seit die Buchpreisbindung 2008 in der Schweiz aufgehoben wurde.

Im deutschsprachigen Bereich der Schweiz gibt es zur Zeit circa 200 Verlage, von denen rund die Hälfte „professionell“ betrieben würden. Thematisch sei die Schweizer Verlagslandschaft breit aufgestellt, fügt Landolf an, dies gälte insbesondere für den Kunst- und Architekturbereich als auch für das Feld der Sach- und Kinderbücher. Auch Wissenschaftsverlage machten ein durchaus herzeigbares Sement aus, wenn sie auch in der Öffentlichkeit nicht sehr präsent seien.
Annette Beger vertiefte sodann das Gebiet der Verlagskalkulation, referierte die prozentualen Anteile, welche sich auf die Buchhandlungen, dem Verlag und den Autor aufteilen, nicht zu vergessen die Kosten für Druck und Distribution. Auf die Frage, wo Verlage denn tatsächlich drucken lassen würden, antwortete Beger, dass der Kommode Verlag in Italien drucken lasse. Dies sei kostengünstiger und trotzdem stimme die Qualität trotzdem. Bücher aus englischen Verlagen fände sie schrecklich, meint Beger, denn diese seien meistens beschichtet, die Beschichtung löse sich nach und nach ab und werde klebrig.
Sodann wurde die Frage diskutiert, wieso es immer noch so wichtig sei, dass die Buchhändler das Recht haben, nicht verkauften Bücher wieder zurück geben zu können. Beger warf ein, dass man bedenken müsse, dass die Buchhandlungen auch Bücher von unbekannten Autoren bestellen und somit immer das Risiko haben, dass die Bücher nicht verkauft werden – was Rolf Lappert, den ersten Gewinner des Schweizer Buchpreises, anmerken liess, dass man ein Buch auch verkaufe, wenn man von ihm überzeugt sei.
Was aber leisten Verlage überhaupt?
Das Podium war sich einig: Sie sind Dienstleister, verwalten die Rechte der Autoren, vertreiben, lektorieren und führen die Promotion für das jeweilige Buch durch. Nicht jeder Autor kann gut lesen, dafür muss man kreative Alternativen entwickeln. Die meiste Zeit nehme das Lektorat ein. Man kann Autoren nur aufbauen, wenn man am Text arbeitet.
Die Frage, ob Autoren Verlage denn auch wirklich als Dienstleister in Anspruch nehmen müssten, bejahte Rolf Lappert. Das Lektorat sei für ihn unglaublich wichtig. Wenn ein Verlag seine Texte zu gut fände und er ein fertiges Manuskript einreiche, welches dann nicht mehr bearbeitet würde, werde er skeptisch. Für ihn sei wichtig, dass das Manuskript richtig überarbeitet werde. Es dürften sich nach einem qualitativen guten Lektorat keine Fehler mehr im fertigen Buch finden. Lappert adressierte dann auch junge AutorInnen der Bieler Schreibschule, deren Manuskripte meist bereits bei Einreichung eine sehr gute Qualität aufwiesen, nicht zuletzt weil sie bereits bei Agenturen überarbeitet worden seien.
Der Austausch gestaltete sich äusserst interessant und eröffnete die Möglichkeit, mehr über die Schweizer Verlagslandschaft zu erfahren. Dani Landolf fragte geschickt nach, blieb hartnäckig, wenn Fragen nicht präzise genug beantwortet wurden und achtete darauf, dass auch die Zuhörer miteingebunden wurden, um deren Französischkenntnisse es nicht so gut bestellt war – wie um die meinen.