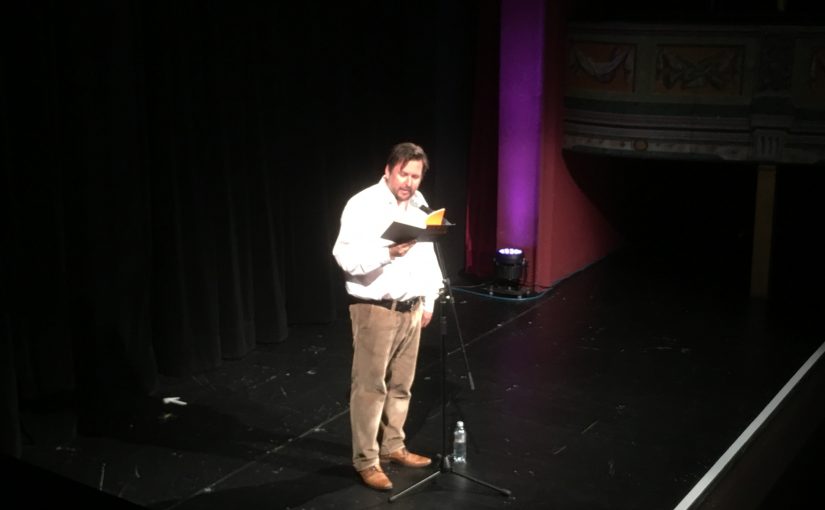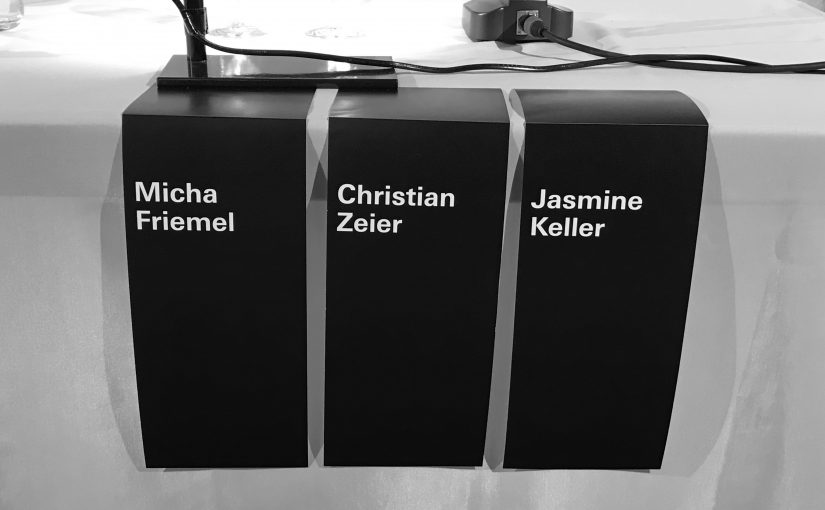Niemand getraut sich so richtig, die erste Sitzreihe direkt am grossen Tisch in Beschlag zu nehmen, an dessen Kopfende bereits Donat Blum, Anna Stern, Ivona Brđanović, Lou Meili, Martin Frank und Lino Sibillano sitzen.
«Ihr dürft schon ein bisschen näher kommen», sagt darum Donat Blum, und alle Besucher*innen rücken eine Reihe nach vorn, sodass jetzt auch die Stühle direkt am Tisch besetzt sind und die Autor*innen mit dem Publikum im Kreis sitzen.
Dem Publikum Autor*innen und ihre gemeinsamen Arbeit an einem Text näher zu bringen, ist das Ziel der Veranstaltungsreihe «Skriptor». Das Format soll einen Begegnungsort schaffen, sagt Donat Blum, der «Skriptor» ins Leben gerufen hat, den literarischen Schaffensprozess für Leser*innen sichtbar machen.
Heute sitzen Autor*innen von «Glitter*», dem ersten und einzigen Magazin für queere Literatur im deutschsprachigen Raum, in der Runde. Besprochen wird ein Text von Lino Sibillano. Er nennt den Auszug eine «Baustelle, einen Anfang von Etwas».
Sibillano liest seinen Text vor, die Autor*innen und Besucher*innen hören zu, verfolgen die Zeilen mit den Augen oder lauschen einfach der Stimme des Autors. Dann eröffnet Donat Blum die Diskussion. Wer jetzt erwartet hat, die Autor*innen würden nach dem Prinzip «zuerst drei positive Punkte, dann Kritik» vorgehen, wird überrascht.
Die Kritik kommt ohne Umschweife, ist ehrlich, präzise, zielt auf Inhaltliches, aber auch Sprachliches. Dabei sind die Autor*innen nicht immer gleicher Meinung. Uneinigkeit entsteht etwa um die Wahl eines Wortes, das auf «-chen» endet. Während sich Donat Blum fragt, was das hier zu suchen habe, sieht Lou Meili darin eine gekonnte Charakterisierung des Erzählers.
Man merkt, wie genau sich die Autor*innen in den Text hineingedacht haben. Hier soll die beste Form eines Textes aus dem Sprachmaterial herausgeschält werden. Dann darf sich auch das Publikum zum Text äussern, auch hier werden genaue Beobachtungen beschrieben. Lino Sibillano hört aufmerksam zu, macht sich Notizen, nimmt auch die direkteste Kritik mit einem Lächeln zur Kenntnis, etwa als Ivona Brđanović eine Textstelle als «Coelho-Moment» bezeichnet.
Zum Schluss sind sich aber alle einig, die Autor*innen und das Publikum: Sibillanos Text hat Potential, einen spannenden Ansatz, der verschiedene Textsorten vereint und mit fiktionalen Ebenen spielt. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich sein fertiger Text lesen wird.