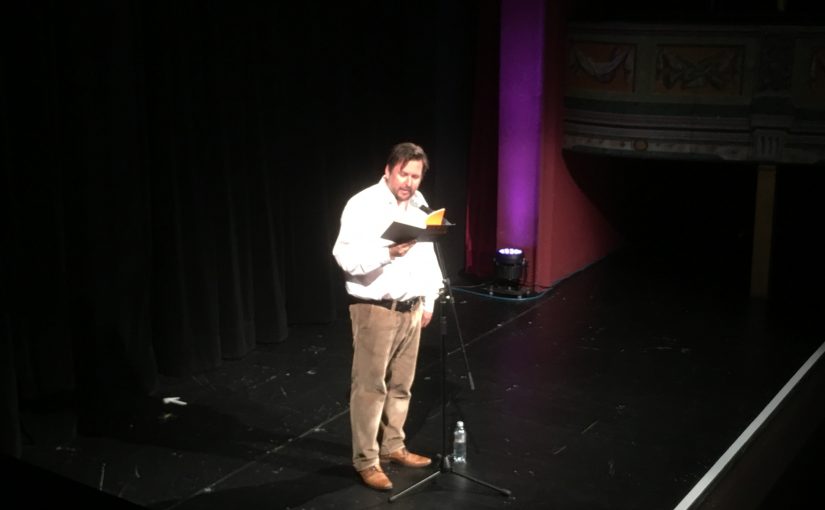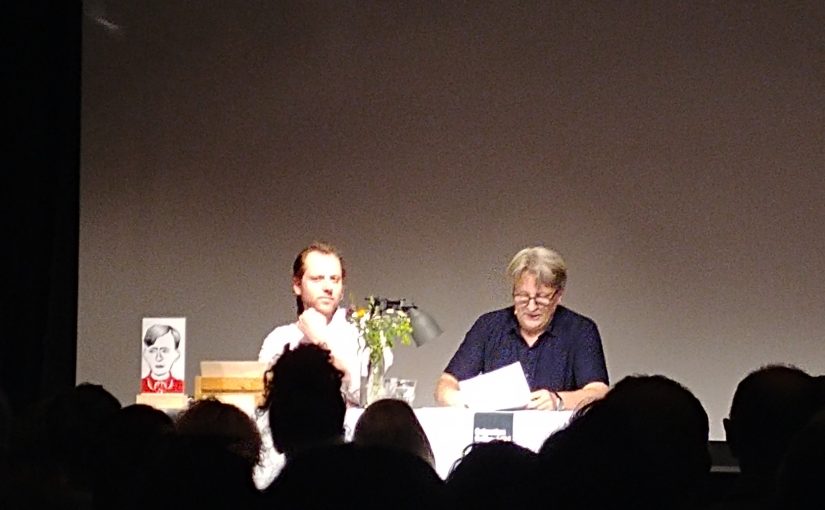Matto Kämpf kennt man witzig und makaber. Der Berner Oberländer, der Märli-Onkel. Auch in seinem neusten Buch Tante Leguan ist der Humor spitzig, kitzelt also, wenn er sanft streicht und schmerzt bei jedem Stich. In Solothurn liest er aus seinem Roman und plaudert mit der Schriftstellerin Milena Moser. Das Kamishibai-Theater bebildert eines seiner Kinderbücher, und dann muss er sich auch noch ein Interview gefallen lassen. Er spricht über Humor, Tod und wieso seine Werke sind, wie sie sind.
Ich hab Sie gestern beim SRF-Gespräch mit Milena Moser im Publikum gesichtet. Für heute war ein Schriftsteller-Dialog mit Ihnen geplant. Wollten Sie Ihr Gegenüber vorab ausspionieren?
Nein, aber ich habe gedacht, ich erfahre vielleicht noch etwas über das Buch. Man hat ja schon die Angst, dass so ein Gespräch komplett abstürzt. Dann hätte ich auf etwas zurückgreifen können.
Für das Gespräch sind Sie ja einander zugewiesen worden. Hat das funktioniert?
Es war angenehm, ich finde das Buch wirklich sehr gut. Sie ist routiniert darin, auf der Bühne über ihre Bücher zu reden und den Leuten zu erklären, wie sie denn schreibt. Daher eine angenehme Bühnenpartnerin.
Zu Beginn haben Sie aus Mosers Buch Land der Söhne und Moser aus Ihrem Buch Tante Leguan gelesen. Haben Sie in Ihrem Text etwas Neues gefunden durch die Weise, wie er von Moser gelesen wurde? Vielleicht ein wenig dem Text entgegen gelesen?
Man kann sich nicht vorstellen, wie Leute den Text lesen. Als ob er nicht von einem selber wäre. Man fragt sich: Ist das jetzt gut – oder schlecht? Es wird spontan ganz anders betont. Ich habe nach zwei-, dreimal lesen so einen Duktus, der bei allen Lesungen identisch bleibt. Heute dachte ich: Ah shit, Leute lesen es ja doch anders.
Als Erzähler haben Sie doch eine einprägsame Stimme. Wie war es, damit einen fremden Text zu lesen?
Ich hatte den Text am Nachmittag schon geübt – also nicht laut. Ich wollte ihn nicht in meinen Stil übertragen, nicht so lustig, so quirlig. Eher wie ein Schauspieler im Radio, sachdienlich gut lesen.
Zitate der Verlagswebsite. Kanton Afrika: «Ein erstaunlich langer Text von Matto Kämpf – fast schon Literatur.» Heute Ruhetag: «Ein erstaunlich dickes Buch von Matto Kämpf – fast schon ein Klassiker!» Jetzt also Tante Leguan, 152 Seiten, schon wieder ein Quasi-Epos. Schieben Sie bald die ruhige Kugel bei den Romanciers?
Das ist schon das Maximum. Satire erschöpft sich doch schnell mal und man hat verstanden, worum es geht. Man kann sie wegschicken und Kreise machen lassen, aber irgendwann ist dann auch gut. Es gibt Bücher, wie bei Moser, die könnte ich nie schreiben – unmöglich. Vielleicht müsste ich zu vier Jahren Haft verurteilt werden. Wenn ich frei bekommen würde und keine Mini-Kühe basteln müsste, dann vielleicht einen Berner-Oberland-Roman über 27 Generationen.
Sie schreiben Postkarten, Kinderbücher, Kolumnen, Erzählungen, machen Spoken-Word bis Film, Musik und Comedy. Wie entscheiden Sie sich für eine Form?
Ich bin so ein Ideenkünstler. Ein Dokument in meinem Compi, das heisst Lager, in das kommt alles rein. Ideen, Sätze, Situationen, Dialogstellen, Dialoge. Die haben erst noch keine Funktion. Und wenn ich mir etwas vornehme, schaue ich das durch und denke, dass der Satz doch die Lena sagen könnte. Meist ist es ein freies Sammeln, wenn ich unterwegs bin. Aber nur vor dem Compi kommt nichts, höchstens ein besseres Adjektiv. Und sobald man im Bus ist, einkaufen geht oder auf dem Weg zum Altglascontainer, dann passiert etwas. Das Hirn braucht Futter wie Tauben.
Viele Ihrer Ideen schöpfen Sie aus einem Fundus aus Sagen, Märli, auch geschichtlichen Ereignissen. Kennen Sie die einfach, oder wo sammeln Sie die ein?
Sagen und Märli sind eine faszinierende Form, um zu erfinden. Das hat etwas Altehrwührdiges, das in Stein gemeisselt ist. Ich behaupte dann, ein grosses Murmeli hat im Berner Oberland die Welt erschaffen. Ein grosses Gebiet sind auch die alten griechischen Sagen, die hab ich nie nachgelesen, aber die höre ich viel. Zum Abwaschen griechische Sagen.
Dem steht Tante Leguan mit einer beinahe schon alltäglichen Handlung entgegen. Wieso das?
Erst war da die Idee dieses Mittdreissiger-Gefühls. Dann hab ich plötzlich die drei Journalisten vor mir gesehen. Die reden über Sachen, die sie gesehen haben, ob sie es scheisse finden oder nicht. Ein lustiges Thema, aber eigentlich geht es mehr um den Groove. Alle, die über das Buch reden, sind Kulturjournalisten. Die fragen, wo mein Problem sei und bestehen darauf, dass es gar nicht so sei. Die drei könnten aber auch an einem anderen Ort arbeiten und wären genau gleich. Halbbatzig Schule geben oder schlechte, halbbeliebte Dozenten.
Zitat aus Tante Leguan: „faul, zynisch, melancholisch und scharfsinnig. – Wie wir.“ Sie mit Mitte dreissig?
Jaja, es ist doch einfach ein Groove, den man zelebriert. Viele Freunde haben mittlerweile seriöse Berufe und Familie, aber sobald man abends mit Bier auf dem Balkon sitzt, fällt man in diesen Groove zurück. Man schimpft über Politiker und findet eigentlich alles scheisse. Wie früher.
Auch bei Ihren Vortragsarten kann man von wirtschaftlicher Diversifikation sprechen. Diashow, Fake-Radiosendung, mit Musik und Film, heute auch als Bildtheater. Sind Wasserglaslesungen fade?
Jein. Bei Lesungen, wie in einer Kantonsbibliothek mit Neonlicht und ohne Bühnencharme, hatte ich nach einer halben Stunde oft das Gefühl, dass ich jetzt wieder nach Hause verschwinden möchte. Aber im Vertrag steht dann halt 60 Minuten. Und dann fand ich es super, einfach nach einer halben, dreiviertel Stunde das Licht auszuschalten und so Bilder anzuschauen. Dann kucken die Leute mich nicht mehr so an. So habe ich dann die erste Diashow-Lesung erfunden.
Früher, als ich vielleicht 20 war, konnte die meisten Autoren nur sehr schlecht lesen. Das war überhaupt kein Kriterium. Bei einer Max Frisch-Buchtaufe hat er irgendwie zehn Minuten gelesen, dann redete er noch sehr lange mit dem Verleger und dann gab’s Apéro. Heute liest man länger und besser, routinierter, weil es ein wichtiger Teil geworden ist.
Bei einer Diashow zeigen Sie ausgestopfte Giraffen, hobbymässig von Ihrem Vater. Nächstes Dia: Leichenkeller, auch vom Vater ausgestopft. Gibt es etwas, worüber Sie nur ernst schreiben würden?
Nein. Ich würde über etwas Ernstes schreiben. Es gibt nichts Lustigeres als den Tod. Ein grosser Erzeuger von Komik. Nicht, dass es lustig ist zu sterben, aber eine Beerdigung ist ja voller Komik. Alles so erhaben, wie man sich benimmt. Das hat so etwas Hilfloses im Verhalten. Man kann über alles mit Humor schreiben.
Und was ist so reizvoll am Humor?
Darunter liegt vielleicht eine Art Sinnsuche. An Konzepte von Lebenssinn oder Religion glaube ich nicht, aber wenn man eine amüsierte Grundstimmung hat, ist man doch einfach glücklich und zufrieden. Wenn mir etwas Lustiges in den Sinn kommt, bin ich wieder versöhnt mit der Welt.
Als ich vielleicht 17 war, lief Monty Python schon in der x-ten Wiederholung. Die haben eine 20-minütige Show gemacht, auf ORF mit deutschen Untertiteln. Jede Woche habe ich die gekuckt. Wenn man Kunst machen will, dachte ich, dann so. Lustig, aber auch absurd. Sketche hören mittendrin auf, dann kommt was komplett anderes, und wenn ihnen nichts mehr einfällt, fällt von oben ein grosses Gewicht herunter. So wollte ich Kunst auch machen; wenn schon.
Wie Monty Python arbeiten auch sie viel mit anderen. Als Die Eltern, als Gebirgspoeten. Unterscheidet es sich stark vom Arbeiten alleine?
Bei Gebirgspoeten sitzen wir alle zusammen vor einem Laptop, damit man nicht alleine zuhause rumsitzt. Es ist lustig, wie man auf andere Ideen kommt. Man schreibt was, das dann jemand falsch versteht. Auch schon Zugfahren ist alleine langweilig. So hat man Treffpunkt Bahnhof Bern und fährt irgendwo gemeinsam hin. Ist sozial einfach interessanter.
Also auch ein wenig wie Ihre drei Charaktere in Tante Leguan.
Ein lustiges Reisegrüppli.
Wenn die drei hier sässen, würden Sie ihnen etwas raten?
Ob sie noch ein Bier wollen. Die wären in irgendeinem Sofa versunken, abgesunken. Am Rauchen und Tapas bestellen.
Abschlussfrage: Was ist der letzte Satzfetzen, der Ihnen geblieben ist, den Sie behalten haben?
Grad heute hat Milena Moser gesagt, mit meinem Buch hätte sie drei lustige Abende gehabt. Als ich darauf antworten wollte, haben Sie grade mein Mikrofon stumm geschaltet. Den Satz schreib ich mir noch auf, als kleines Bonmot:
Immer wenn man lacht, will man sich doch einfach kurz nicht umbringen.
Autorenfoto; (c) Der gesunde Menschenversand GmbH (ohne Sprechblase).