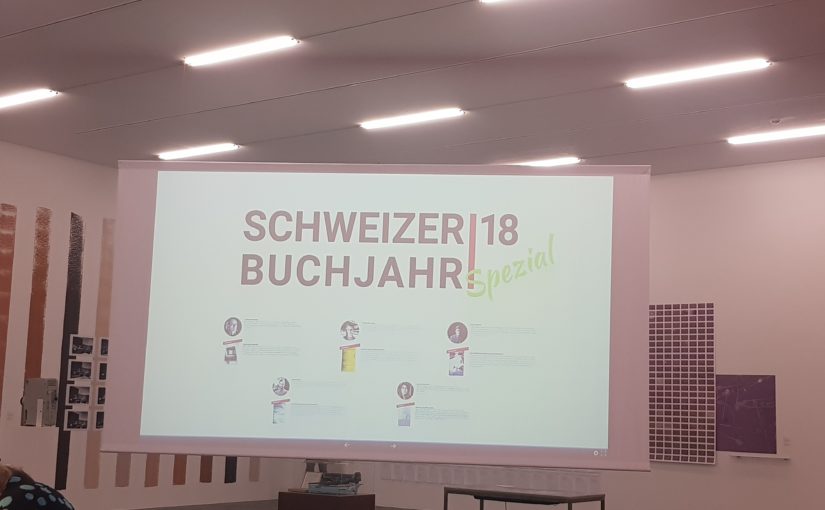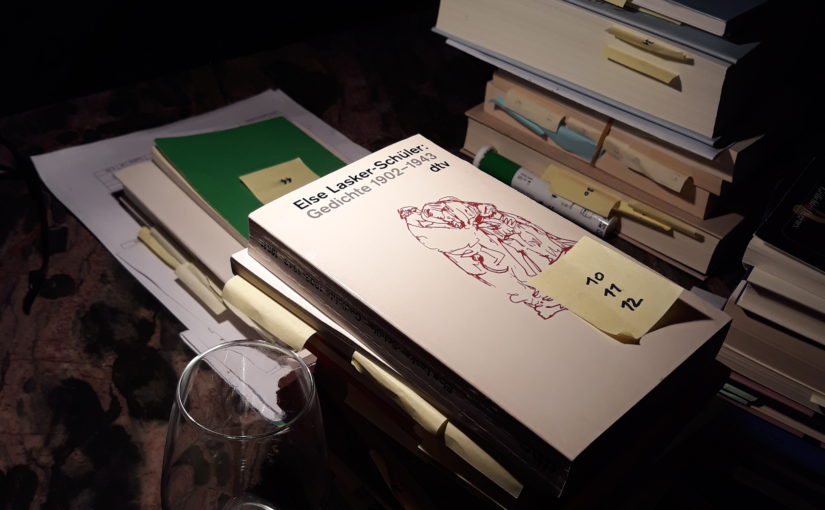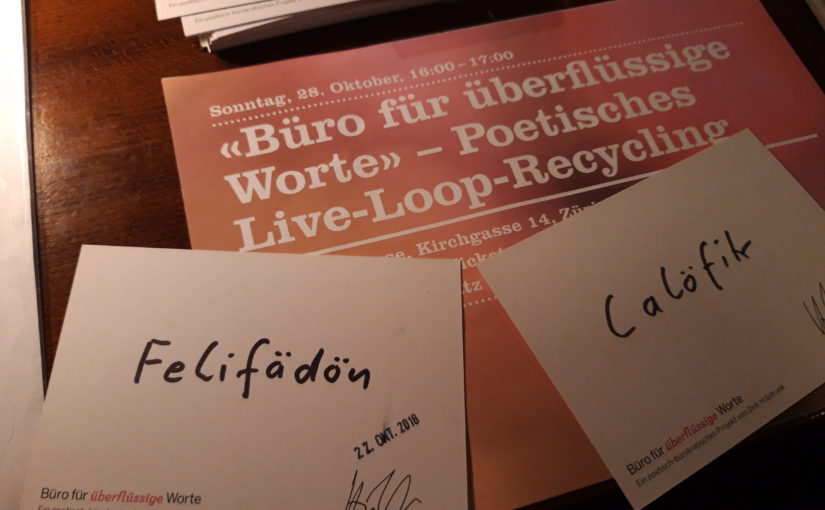Das zwölfköpfige Autorinnen und Musikerkollektiv «Bern ist überall» macht schon länger von sich reden. Dieses Jahr haben die Mitglieder sich Unterstützung aus dem Kosovo geschnappt und kurzerhand eine Tournee organisiert – durch den Kosovo und die Schweiz, CD-Produktion inklusive. Am frühen Samstagabend sind Blerina Rogova Gaxha, Antoine Jaccoud, Shpëtim Selmani und Ariane von Graffenried, musikalisch unterstützt durch Adi Blum am Akkordeon zu Gast im sogar theater und performen zusammen.
Vielsprachigkeit und Vielstimmigkeit. Ganz im Zeichen davon steht die gut einstündige Performance der Fünfertruppe. Das Schöne daran: Jede und jeder von ihnen hat eigene Beiträge – und immer wieder spannen mehrere von ihnen zusammen, um gewisse Stücke gemeinsam vorzutragen. Dabei stellen sie unter Beweis: Das Ganze ist weit mehr als die Summe der Einzelteile. Wie wichtig diese Einzelteile indes sind, zeigt sich schon bald.
Ganz links auf der Bühne steht Antoine Jaccoud. Seine Texte, mehrheitlich englisch oder französisch, trägt er mit leiser Stimme und einem leisen Schmunzeln im Gesicht vor. Er ist der fein lakonische Polemiker des Abends: «We got to heaven, but there were no virgins there. Not a single one. We waited for a while, maybe they were late, but they didn’t come.»
Rechts neben ihm Blerina Rogova Gaxha. Auch sie mit feiner Stimme, aber mit viel persönlicher anmutenden Texten. Mal über ein «Ich», mal über andere Menschen: «Lieber Gott, vergib mir. Ich will sterben zwischen ihren Beinen. – Ali sang über die Liebe».
Ariane von Graffenried, rechts von ihr, deckt mit ihren Texten ein breites Spektrum an Themen ab. Ihr «unique selling point» ist ganz klar die Vielsprachigkeit: «I mim Gring dräit aus im Chreis, à la télé louft Kosova RTK eis».
Shpëtim Selmani ist – zumindest nach seinen Texten zu Urteilen – der politischste der vier. Mit wilder Frisur und Brille redet er über die kosovarische Regierung, über das Heilige – über das, was ihm daran lieb und fremd ist. Sein vielleicht schönstes Bild des Abends: «Kosovo ist ein Holzapfel, der im geröteten Hals eines Deutschen feststeckt.»
Ein Abend der deutlichen Stimmen und der vielen Sprachen also, bei dem die Sprachbarriere zuweilen sogar bereichernd wirkt. Blerina Gaxha und Shpëtim Selmani tragen ihre Texte auf Albanisch vor. Zwar gibt es Übertitel, die das Verständnis erleichtern, doch es gibt noch einen anderen Effekt: Bei einer Sprache, deren Wörter man nicht versteht, achtet man sich beim Zuhören gezwungenermassen viel mehr auf Rhythmen, Reime und die Melodie.