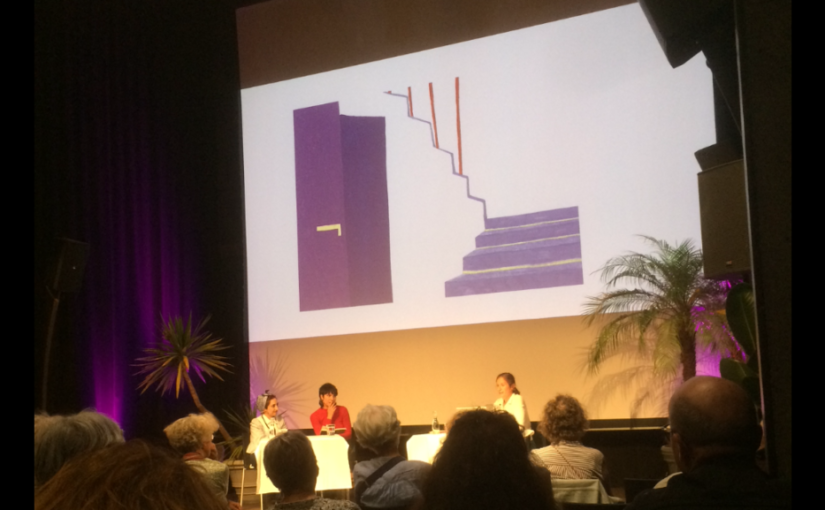Draussen: Die flaschengrüne Aare, eine heitere Stimmung, Sonne, Glacé etc. Drinnen: Eine Podiumsdiskussion zur «Rolle des/der Autor*in in der Gesellschaft». Manch eine*r dürfte sich fragen, ob es zu diesem Thema überhaupt noch etwas Neues zu sagen gibt. Wenig erstaunlich ist es, dass dieses Podium nicht zum Publikumsschlager avanciert. Der Gemeinderatssaal ist zwar gut gefüllt, fasst aber bei Weitem nicht so viel Besucher*innen wie andere Veranstaltungsorte an den Solothurner Literaturtagen. Interessanterweise befinden sich dafür einige Autor*innen im Publikum.
Eröffnet wird das Podium von der Moderatorin Christa Baumberger. Souverän führt sie an das Thema heran und wechselt dabei fliessend vom Deutschen ins Französische. Die Veranstaltung findet bilingue statt; die Teilnehmer*innen sprechen jeweils ihre Sprache, zwei Simultandolmetscherinnen übersetzen. Baumberger hebt hervor, dass sie im Folgenden die historische Perspektive ausklammern und stattdessen das Heute in den Fokus rücken will. Dann gibt sie ihren drei Gästinnen das Wort, die jeweils einen kurzen Text zum Thema vorlesen; nach jeder Lesung folgt eine kurze Diskussion.
Drei Texte, drei Perspektiven
Autorin und Regisseurin Ivna Žic macht den Anfang mit einem Auszug aus ihrer Hamburger Poetikvorlesung. Es ist ein differenzierter, essayistischer Text, den sie vorträgt. «Warum sich nicht wundern über die, die anscheinend seit immer an einem Ort hocken und bleiben?», fragt sie in den Raum und begegnet damit der misstrauischen Neugierde, die Migrant*innen und sog. «Secondos» entgegengebracht wird. Zum Abschluss plädiert sie für eine «Gleichzeitigkeit der Perspektiven, Wege, Orte und Sprachen» – vor allem auch in der Literatur. Die anschliessende Diskussion dreht sich hauptsächlich um das Verhältnis zwischen Sprache und Macht. Žic hebt hervor, dass gerade klare Setzungen und Festschreibungen in der Sprache gefährlich werden können; sie sind zwar leichter zu verstehen und kontrollieren, geben aber nicht die Polyphonie der Wirklichkeit wieder.
Als Zweite bekommt Herausgeberin und Autorin Noémi Schaub das Wort. Sie liest einen lyrischen Text aus Romy Colombes Debut «Quelques fleurs» vor. Colombes Text kommt gleichzeitig sehr poetisch und ausserordentlich kämpferisch daher. Er thematisiert die Dominanz der «alten weissen Männer», und entlarvt die Unterdrücker als Menschen, die in erster Linie Angst vor der tatsächlichen Vielfalt des Lebens hätten. Die anschliessende Kurzdiskussion ist der «Macht der Poesie» gewidmet. Nach Schaub ist politische Sprengkraft der Lyrik vor allem ihrer kondensierten, kompakten Form geschuldet. In der Lyrik, so Schaub, würde nichts verwässert.
Den Abschluss macht Nathalie Garbely, die als Autorin und Übersetzerin tätig ist. Garbely legt einen sehr lyrischen Text vor, der auch die Simultandolmetscher*innen ins Schwitzen bringt. Auf die Schnelle aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, ist ihr Beitrag – Auszüge aus dem Text «Passer le seuil de la pudeur» – für die nicht-frankophonen Zuhörer*innen leider etwas unzugänglich. Den politischen Inhalten (etwa dem Thema der «droite décomplexée») nähert sie sich in einer sehr bildhaften Sprache. Garbelys Arbeit dreht sich darum, «in den Begriffen selbst Verschiebungen anzubringen und die Sprache zu öffnen», fasst Baumberger zum Schluss zusammen.
Eine abschliessende Antwort?
Was bleibt nun aber nach den ganz unterschiedlichen Texten, die im Laufe des Podiums vorgetragen wurden? Eine Quintessenz ist schwer herauszudestillieren, aber gerade darin liegt wohl der grosse Trumpf dieser Gesprächsrunde: Sie war ein perfomatives Plädoyer für eine Vielfalt der Perspektiven, Sprachen und Herangehensweisen. Tatsächlich wird die anfängliche Frage nach der Rolle des/der Autor*in auch noch einmal explizit durch eine Wortmeldung aus dem Publikum aufgegriffen. Žic antwortet pointiert, dass auch hier eine gewisse Pluralität wünschenswert sei. So gäbe es für sie nicht die Rolle des/der Autor*in in der Gesellschaft. Und wenn sie doch eine Rolle wählen müsste, dann bestünde diese eben genau darin, «die eine Zentralperspektive aufzulösen».