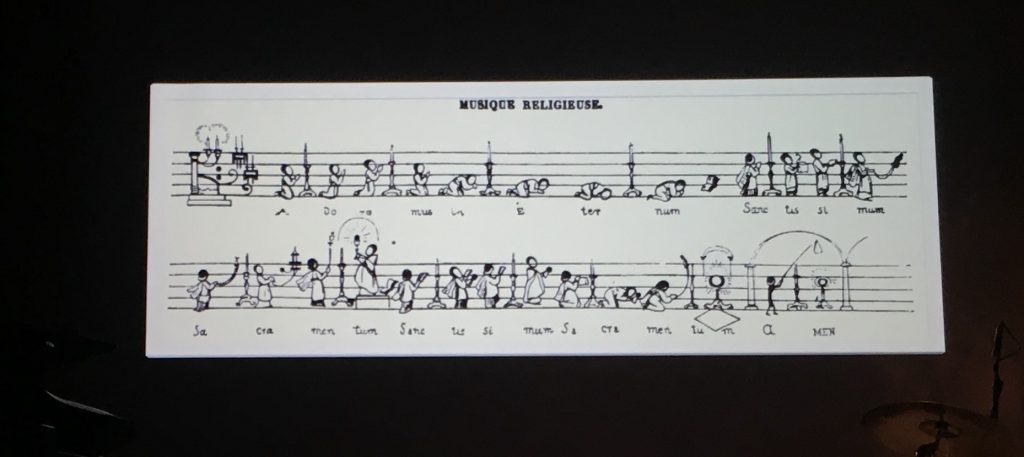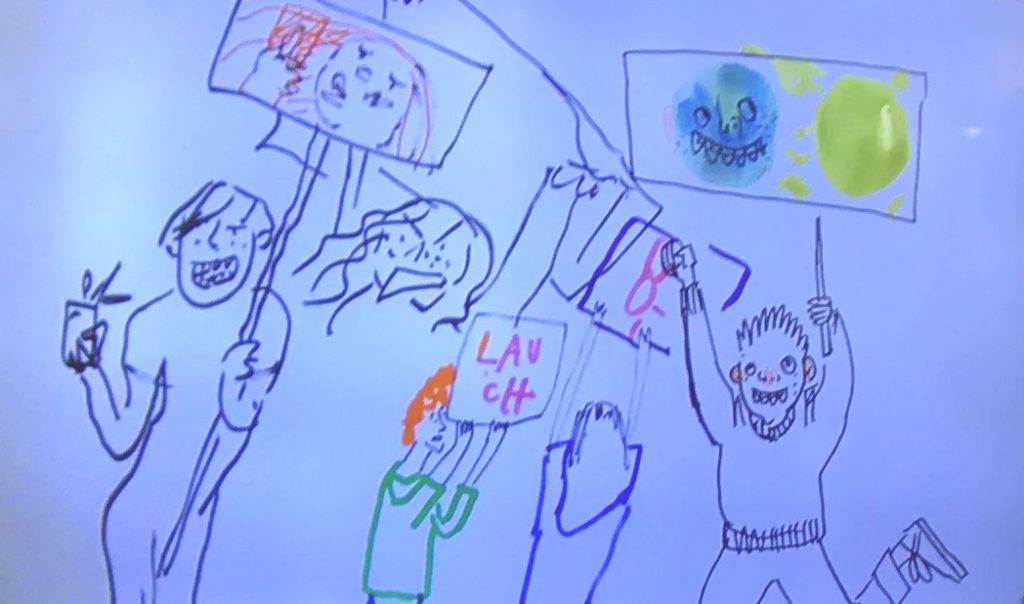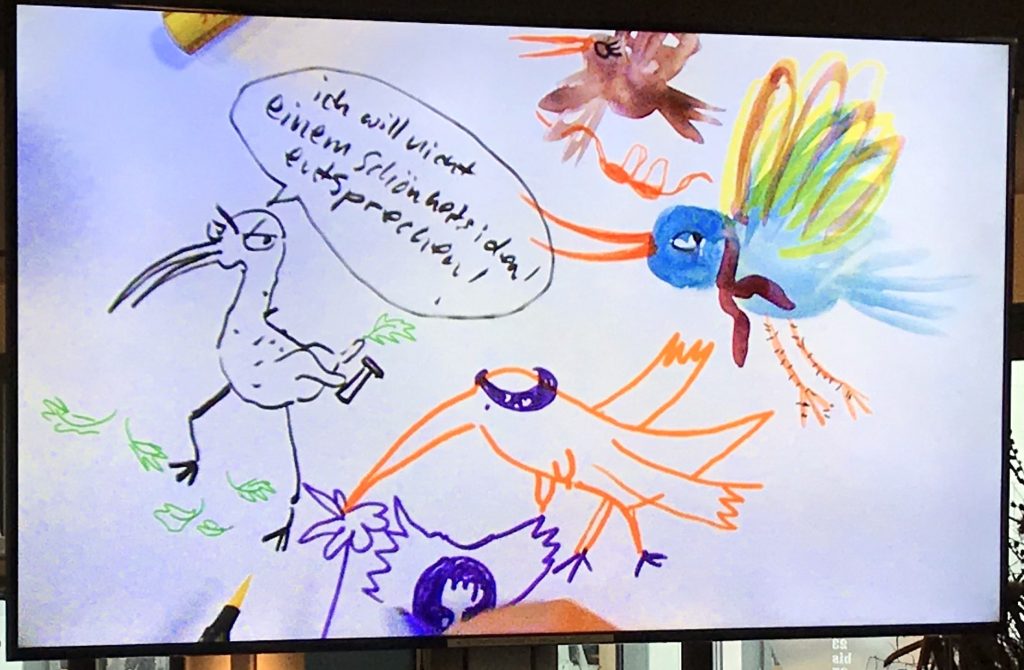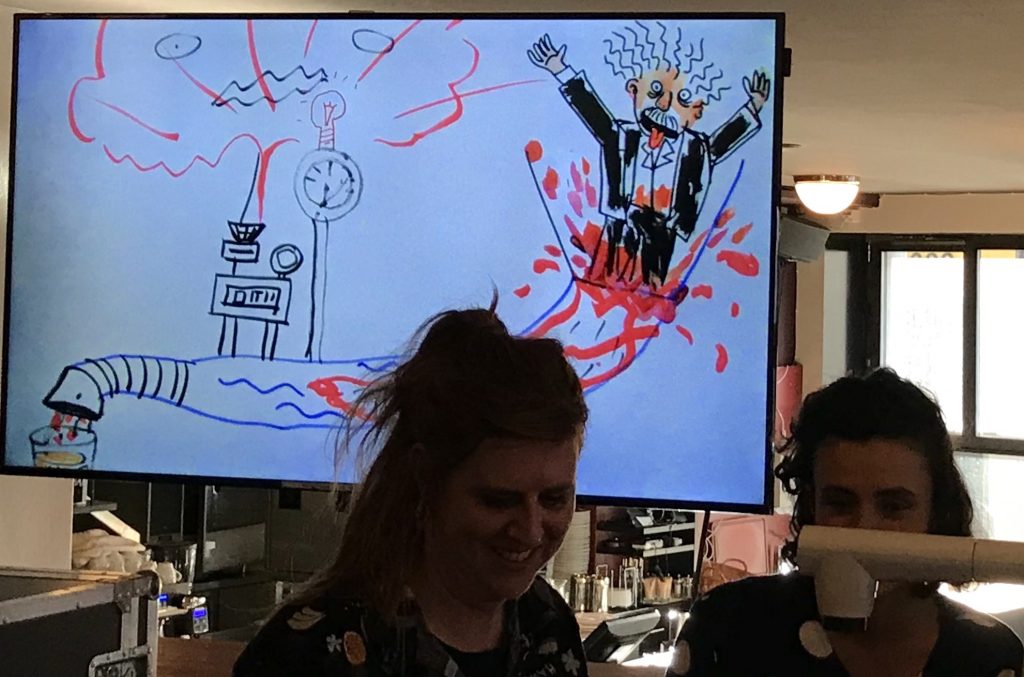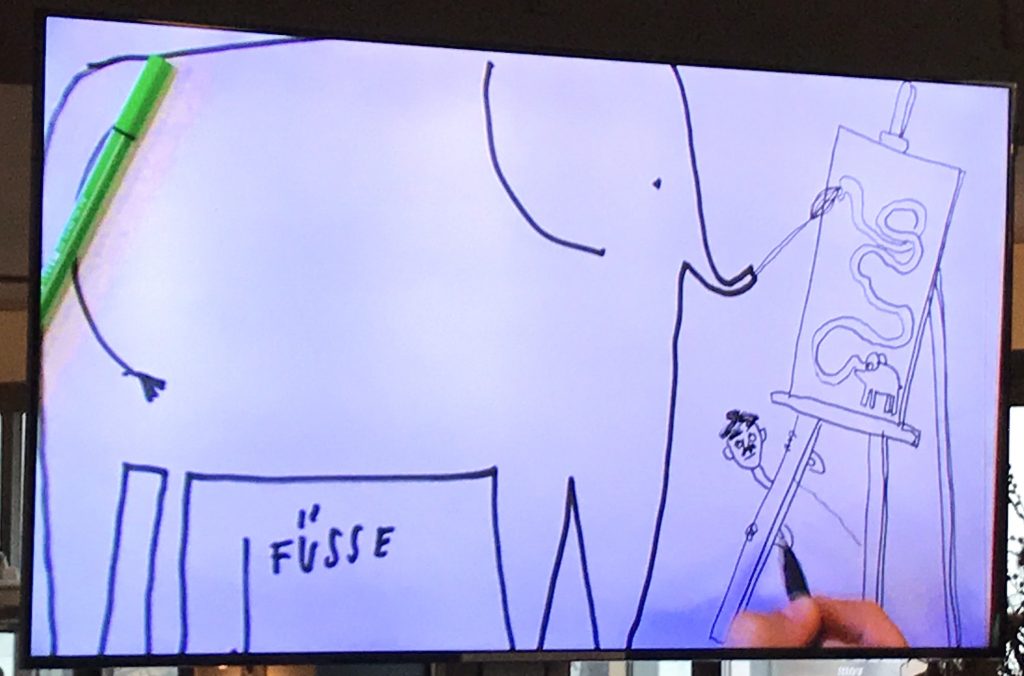Wir haben die neue Mediensymbiose von «Exklusive Vorpremiere: «LOS 360°VR (RC)» – eine Lesung durch scheinbare Räume im Rahmen» besucht und uns nach einer Flut von Sinneseindrücken zu untenstehenden Fragen Gedanken gemacht. Wie diese Veranstaltung technisch abläuft, wird bereits in diesem Beitrag erläutert.
Was hat dir am besten gefallen?
A: Die Szenerie der verschiedenen Räume war mit vielen spannenden Details gefüllt. Diese zu erkunden, war ein faszinierendes Abenteuer. Besonders imposant fand ich den Raum des Meeres. Der Zuschauer befindet sich dicht genug unter der Oberfläche, um das Rauschen der Wellen zu vernehmen, kann aber gleichzeitig einen Blick in die Tiefe werfen.
X: Das war für mich eindeutig die erste Szene, die einen Theatersaal in abgedunkeltem Licht am Abend zeigte. Diese war sehr realitätsnah und es hat Spass gemacht, die Leute um sich herum zu beobachten. Die Stimmung war hier sehr angenehm und auch das Tête-à-Tête mit Klaus Merz war als Einführung ein raffiniertes Detail.
Was hat dir nicht so gefallen?
A: Sich in einer VR zurechtzufinden, bedeutet immer auch sich sehr vielen Sinneseinflüssen gleichzeitig auszusetzen. Im Gegensatz zu einem klassischen Kinobesuch ist es aber nicht möglich sich vom Bild abzuwenden. Selbstverständlich macht das einen Grossteil der imposanten Wirkung des VR aus; über eine Zeitspanne von einer halben Stunde ist es jedoch auch sehr ermüdend.
X: Die Übergänge zwischen den Sequenzen empfand ich oft als verwirrend. Ich denke, dass mir klarere Übergänge einen besseren Überblick vermittelt hätten. Die Szene mit den beiden Reitern konnte ich nicht in einen Zusammenhang setzen, das hat mich mehr verwirrt als begeistert.
Wie hat in deinen Augen die Symbiose von Literatur und VR funktioniert?
A: Teilweise gut, teilweise weniger gut. Die erlebten Szenerien
waren für mich mit der Stimme von Klaus Merz stimmig. Die Hintergrundgeräusche
der Räume – brechende Wellen, tuschelnde Theaterbesucher, heulende Schneegestöber
– waren mir persönlich zu laut. Entsprechend rückte die Stimme und somit die
Erzählung in den Hintergrund.
X: Grundsätzlich denke ich, dass die Symbiose eine grossartige Idee ist und bei sich passend gewählter Literatur sehr gut funktionieren kann. Ich empfand jedoch bei diesem Projekt den Inhalt der Erzählung als zu schwerwiegend für eine Visualisierung mit der VR-Technik.
Wem würdest du den Besuch empfehlen?
A: Ziel des Projektes war es, eine grössere Masse an Zuschauenden anzuziehen, was – wenn man die Vorführungen im Rahmen von Zürich liest zählt – durchaus gelungen ist. Dennoch scheint mir das Projekt immer noch auf ein sehr spezifisches Segment zugeschnitten, da mit Klaus Merz’ LOS eher schwerere Lektüre gewählt wurde, die wohl nicht allen zusagt. Trotzdem empfehle ich den Besuch denjenigen, die bis jetzt noch nicht in den Kontakt mit VR gekommen sind. Die Bilder sind ein Erlebnis für sich.
X: Klaus Merz-Fans wären sicherlich angetan, genauso wie Personen, die vorwiegend an Literatur und etwas weniger an Technik interessiert sind. Für Kinder empfinde ich die Technik als geeignet, den Inhalt der Erzählung jedoch als unpassend. Personen, die nur an der VR-Technik interessiert sind, würde ich vermutlich ein anderes Projekt empfehlen, da hier berechtigterweise die Literatur und ihr Inhalt klar im Vordergrund stehen.
Wie siehst du die Zukunft dieser Mediensymbiose?
A: Gerade jetzt, wo VR oder auch AR (Augmented Reality) vermehrt auf den privaten Markt kommt, glaube ich, dass einige neue Medienformen wie das Projekt 360° entstehen. Es ist aber auch klar, dass solche die bestehenden Formen weder ersetzen können noch sollen.
X: Ich denke, dass die VR-Technik für Kurzfilme sehr gut geeignet ist und auch ein Literaturprojekt sinnvoll damit realisiert werden kann. Andere kürzere Filme oder Aufnahmen könnten so realitätsnah ausfallen, was ich mir besonders für sehr bildhafte Literatur gut vorstellen könnte. Ich bin jedoch nicht der Meinung, dass daraus lange Kinofilme entstehen werden.
Xenia Bojarski und Anouschka Mamie