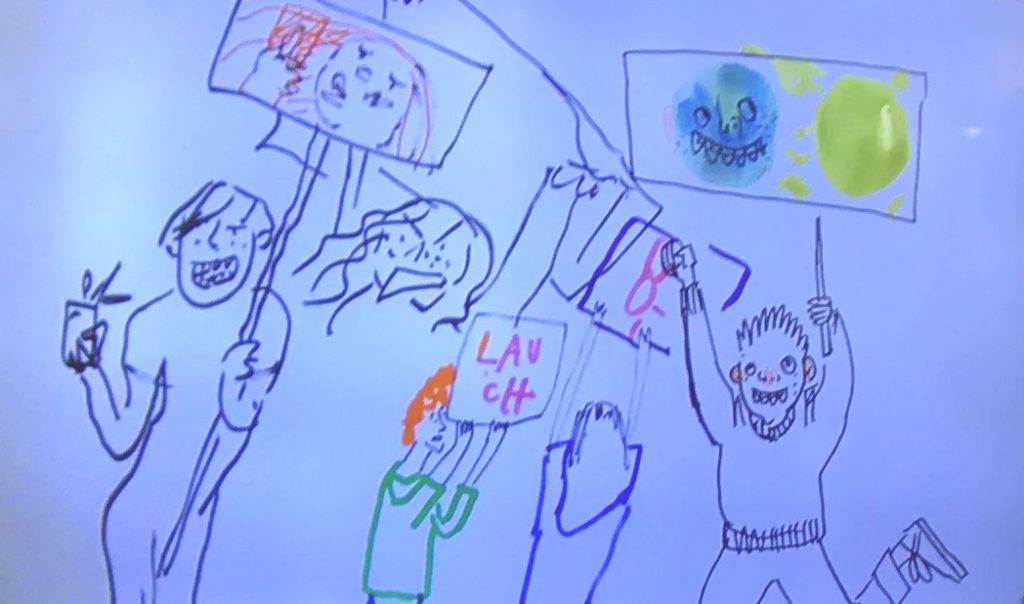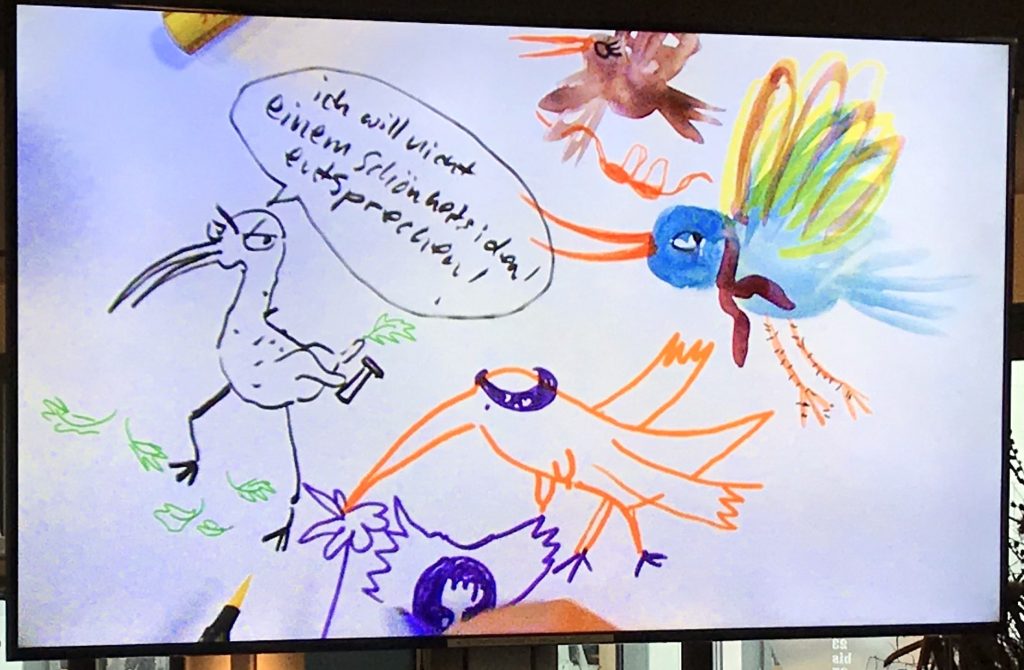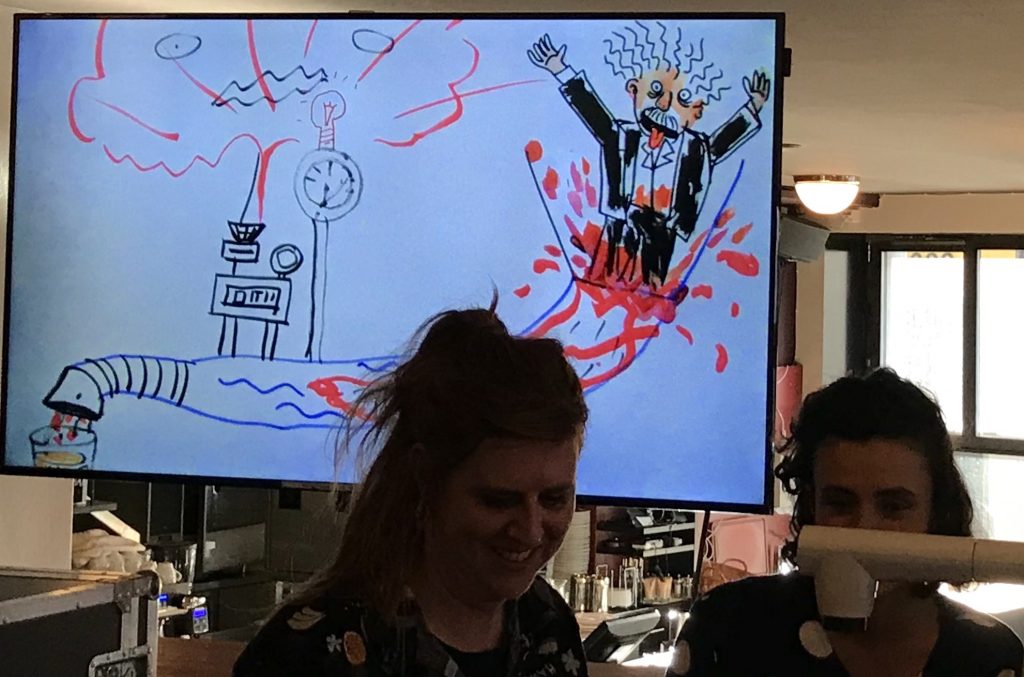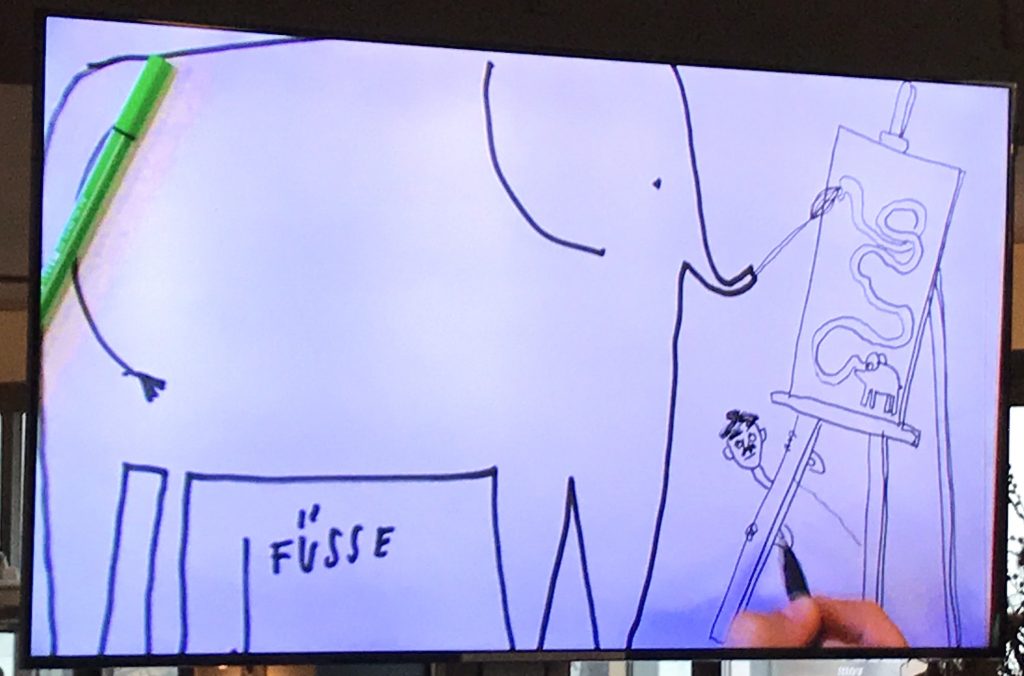In der letzten Veranstaltung des «NZZ Tag des Lesen» sollte es am Sonntagabend im Kosmos sowohl um gewichtige Autor*innen als auch um Neuentdeckungen gehen, wenn sich traditionsgemäss die drei NZZ-Redaktor*innen Claudia Mäder, Thomas Ribi und Martina Läubli über lesenswerte Bücher der Saison unterhalten und einen fachkundigen Gast in ihre Runde einladen. An diesem Abend ist das Philipp Theisohn, Literaturprofessor der Universität Zürich und Herausgeber des Schweizer Buchjahrs. Natürlich wurden die erhofften Leseempfehlungen ausgesprochen, aber es wurden auch grundlegendere Fragen diskutiert.
Der Elefant im Raum wurde gleich zu Beginn angesprochen, denn an diesem Buch kommt man zurzeit nicht vorbei. Die langersehnte Fortsetzung von Margaret Atwoods «Der Report der Magd» wurde nach 34 Jahren und einer erfolgreichen TV-Serie mit Spannung erwartet. «The Handmaid’s Tale» heisst der erste Band im Original und kann heute mit gutem Gewissen als «moderner Klassiker» bezeichnet werden. Die Erwartungen waren also gross und ebenso gross die spürbare Ernüchterung unter den Kritiker*innen. Atwoods neuer Roman «Die Zeuginnen» hält, so die einhellige Meinung, nicht, was sein Vorgänger verspricht. So ärgerte sich Claudia Mäder während der Lektüre immer wieder über die schwache Sprache und die schematische Erzählweise: «Der Text ist anspruchslos, langweilig und vor allem vorhersehbar.» Die Chance, zu zeigen, wie die gesellschaftlichen Strukturen des ersten Teils implodieren, werde verpasst. Es würden zwar alle offen gebliebenen Fragen beantwortet, aber dadurch ginge auch die Qualität der Dystopie verloren. Durch die starke Visualisierung und expliziten Erklärungen im Text dränge sich der Verdacht einer engen Verwobenheit zwischen Buch und TV-Serie auf. Dabei stelle sich die Frage, ob Literatur in Zukunft immer mehr nach dem Serienprinzip funktionieren werde. Philipp Theisohn beobachtet diese Entwicklung bereits seit einiger Zeit, allerdings lernen die Serien wie «Game of Thrones» auch von der Literatur und funktionieren nach literarischen Prinzipien.
Als nächstes stand das Werk eines weitaus weniger bekannten Autors im Mittelpunkt. Bei «Nach Notat zu Bett» von Heinz Strunk handelt es sich um einen autofiktionalen Text. Der Ich-Erzähler Heinz ist ständig mit Projekten beschäftigt, die dann doch nie fertig werden. Sein Alltag, den er ein Jahr lang tagebuchartig festhält, ist geprägt von Ritualen und Nachbarn mit komischen Marotten. Während Heinz selber in Nichtigkeiten zu ertrinken droht, scheint man als Leser*in Gefahr zu laufen, demselben Schicksal zu erliegen, wenn Heinz beispielsweise jeden Abend minutiös seinen Google-Suchverlauf ausbuchstabiert. Hält man diesen unsäglichen Alltag zwischen Nichtigkeiten jedoch aus, stösst man auf tiefe, grundlegende Fragen und trifft mit Heinz auf einen Kulturkritiker, der sich von der Hochkultur bis zur «Trashkultur» alles anschaut und deshalb auch moralisch werden kann. Ein Buch, bei dem man sowohl lauthals lachen als auch über tiefere Dimensionen nachdenken kann.
Bachtyar Ali hingegen erzählt in «Perwanas Abend» die Geschichte zweier Schwestern. In der Stadt ist kein Platz für junge Frauen, ihre Träume, Talente und besonders nicht für ihre Liebe. Väter, Brüder und Hüterinnen des Glaubens machen ein erfülltes Leben unmöglich. So verschwindet eine nach der anderen mit ihrem Geliebten ins Tal der Liebe. Perwanas Schwester Khandan bleibt jedoch zurück und muss nun die Konsequenzen für Perwanas Verschwinden tragen. Dieser Text schwankt zwischen dem Gefühl aus Tausendundeine Nacht und einer unerhörten Brutalität, die schonungslos geschildert wird. Bestimmt kein leichter, aber dafür umso lesenswerterer Text, so sind sich die Redner*innen einig, den man bestimmt auch ein zweites Mal gerne liest, um alle Allegorien und eindrücklichen Bilder auf sich wirken zu lassen.
Den Schluss machte der neue Roman «Eine Familie» der Schweizer Autorin Pascale Kramer, mit welchem sie erneut beweist, dass sie «eine Meisterin der feinen Zwischentöne ist». Die Familie kommt zur Geburt des Enkelkindes in Bordeaux zusammen, doch alles scheint sich nur um eines zu drehen, um den, der nicht da ist. Romain, der älteste Bruder, ist stark alkoholkrank und trank sich bereits als Jugendlicher ins Koma. Alle Hilfsversuche der Familie scheitern. Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert, die alle aus der Perspektive eines anderen Familienmitglieds geschrieben sind. Bei Kramers Liebe fürs Detail ist es wenig überraschend, dass man beim Lesen aufmerksam hinschauen sollte, wenn man herausfinden will, wieso eigentlich immer alle nur von Romain sprechen. Ist er am Ende sogar das Glied, das die Familie zusammenhält? So fasst Philipp Theisohn zusammen: «Bei diesem Roman handelt es sich um eine Deckgeschichte, und die Aufgabe des Lesers ist es, die Decke zu lüften.»