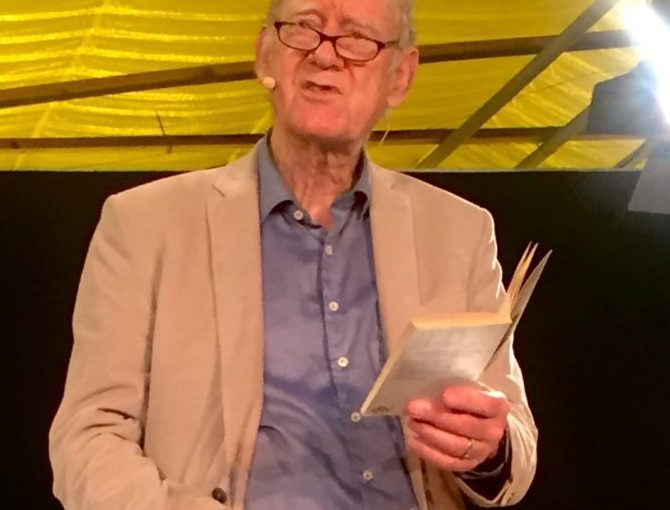Manchmal zahlt es sich aus, früher als nötig am Ort des Geschehens einzutreffen (wenn auch nur, weil man sich in der Wegzeit verschätzt hat). So ist es beim heutigen Anlass «JULLliest – Kinder und Jugendliche lesen eigene Texte» nicht anders.
Die Stimmung im Foyer des Kaffeehauses zur Weltkugel ist voller Aufregung. Gäste sind erst spärlich vorhanden, dafür habe ich die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Nicht nur darf ich die jungen Schreiberlinge des JULL bei ihren letzten Vorbereitungen vor der Lesung beobachten, wie sie durch ihre Texte blättern und sich zum (vermutlich) hundertsten Mal versichern, dass auch wirklich jede Markierung da ist, wo sie sein soll: Nein, es ergibt sich sogar, dass ich ein paar Worte mit Richard Reich, einem der beiden Leiter des Jungen Literaturlabors, wechseln kann.
Zwei Dinge werden im Gespräch schnell klar. Erstens: In JULL steckt unglaublich viel Herzblut. Die Passion der Schreibenden, der Schreibcoaches und der Organisierenden verleiht jedem der vielzähligen Projekte Einzigartigkeit. Dem Motto des JULL – «never write alone» – treu, ist es die Zusammenarbeit verschiedenster Persönlichkeiten, die das Gespür für Literatur fördert, wo es schon vorhanden war. Und an Orten, wo Lesen und Schreiben davor nie mehr war als eine Hausaufgabe, entzündet es sogar den Funken, aus dem eine Leidenschaft für etwas zuvor Unbekanntes entsteht.
Zweitens: Meine Vorfreude auf die Lesung ist nur noch mehr gewachsen.
Pünktlich Sechs Uhr abends, die Tür zum Lesesaal öffnet sich. Der Andrang ist nicht gerade klein und es dauert nicht mal drei Minuten, ehe Tische rausgetragen werden, um Platz für eine zusätzliche Stuhlreihe zu schaffen. Gleich darauf wird auch schon der Grossteil der Lichter gedimmt und der Fokus des Publikums fällt auf die erhöhte Bühne.
Die ersten Texte stammen von vier Schülerinnen aus Rüti, die
uns ihren Wohnort mit humorvollen Erzählungen um einen Krieg der Dönerbuden
oder auch einer grauenvollen Schilderung einer auf Gleisen abgelegten Leiche näherbringen.
Obwohl die Texte noch nicht abgeschlossen sind, vermögen sie die Stimmung eines
lebendigen Rüti überzeugend einfangen.
Als nächstes wird ein Text über einen Jungen mit einem «bösen» Gesicht und ein Mädchen, das nicht hören kann, vorgelesen. Diese Geschichte stammt aus einem Langzeitprojekt mit dem Schulhaus Feld. Die coachende Autorin bezeichnet diese Art Projekte als «Wundertüten», da sie in ihrer inhaltlichen Gestaltung in keiner Weise eingeschränkt sind und entsprechend kein Ergebnis dem letzten gleicht.
Darauf wird das Publikum auf eine sprachliche Reise mitgenommen:
Es wird Spanisch. Drei junge Schreibende präsentieren Textstellen aus ihren Werken;
mit dabei ein wichtiges Werk der mexikanischen Gegenwartsliteratur. Ausser
Mimik, Gestik und Tonfall (und dem einen oder anderen Wort, das mir aus dem
Französischen bekannt vorkommt) verstehe ich leider nicht viel. Aber eins ist
klar, dies reicht vollkommen aus, um mich neugierig zu machen, was denn nun die
Ursache für das plötzliche Flüstern oder die skeptisch hochgezogene Augenbraue
der Vortragenden war.
Als viertes betreten drei Vertreter der Stadtbeobachter*innen
die Bühne, einer Gruppe von Jugendlichen zwischen 15 und 25, die sich zweimal
monatlich zum gemeinsamen Schreiben und Diskutieren trifft. Über das Leben
einer Blechdose, dem Portrait einer mittlerweile alten Frau und einem Ausflug
in die Lyrik über «Wir Leute in Zürich», alles ist mit von der Partie.
Abschliessend werden «Fragen an den Mann/die Frau» gelesen, die im Rahmen des
Frauenstreiks entstanden sind. Einmal mehr zeigt sich: Das JULL bleibt aktuell.
Während viele der Projekte mit Klassen durchgeführt werden, gibt es auch vereinzelte Förderprojekte. Fast ein ganzes Jahr habe die Zusammenarbeit dieses Schülers und seiner Mentorin angedauert, aber jetzt könne er sein fertiges Buch präsentieren. Eine Liebesgeschichte ist es, die er geschrieben habe, eine Liebesgeschichte, die zugleich seine persönlichen Eindrücke von der Flucht aus Eritrea in die Schweiz verarbeitet. Die Zuschauer horchen atemlos, während er einen Ausschnitt vorliest. Die Geschichte ist vieles zugleich: emotional, ehrlich, eindrücklich.
Den Schluss macht ein Trio bestehend aus zwei Schülern und einer Autorin, die sich im vierten Quartal des letzten Schuljahres mit dem Projekt «Green Henry» befasst haben. Um die Lektüre des zugegebenermassen nicht gerade einfachen Werkes «Der grüne Heinrich» von Gottfried Keller zu erleichtern, haben die Schüler zuerst eine englische Ausgabe gelesen und diese in eigenen Worten ins Deutsche übersetzt. Heute haben sie eine Textimprovisation mitgebracht, in der über verschiedene Charaktere und Situationen des Originals verhandelt wird. Vielleicht ist die Handlung auf Grund des Ausschnitts nicht viel verständlicher für die Zuschauer, aber das wilde Hin und Her an Figurenzeichnungen und Gedankenexperimenten kann die «verstaubte Antiquität», wie es die Autorin mit nicht wenig Liebe in der Stimme nennt, für das Publikum zum Leben erwecken.
Die Mehrheit der am heutigen Abend präsentierten Projekte ist, wie bereits erwähnt, noch nicht abgeschlossen und entsprechend im Shop des JULL noch nicht erwerbbar. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, lohnt es sich allemal einen Blick auf die Reihe «Züricher Reformationsnovellen» (Print 20-24 bei JULL) zu werfen, die ebenfalls in der Zusammenarbeit mit fünf Schulklassen entstanden ist und fünf Persönlichkeiten der Schweizer Reformation vorstellt.
Abschliessend kann ich nur anmerken, dass sich lediglich eine der am heutigen Abend gemachten Aussagen als unwahr erwiesen hat. «Jetzt chunt öise Nachwuchs, am achti denn d’Profis» hiess es bei Türöffnung. Aber wenn die Schreiberlinge des Jungen Literaturlabors an diesem Abend eins bewiesen haben, dann, dass sie es mit den «Profis» ohne Weiteres aufnehmen können.