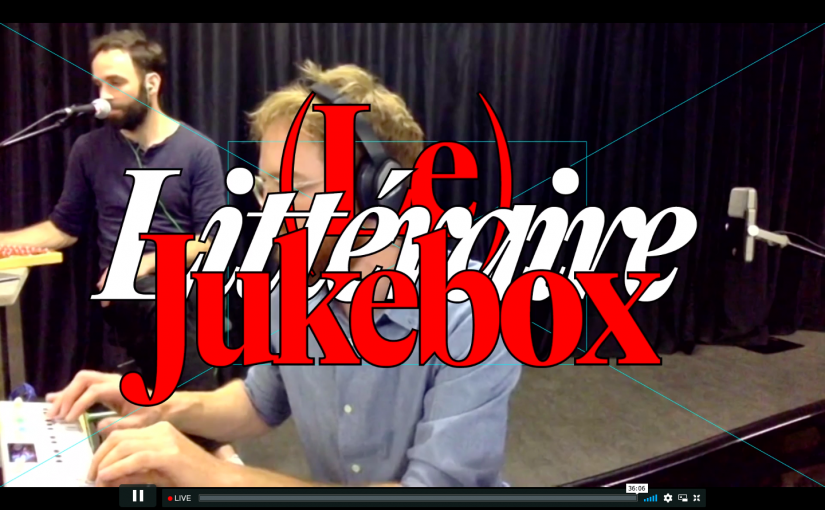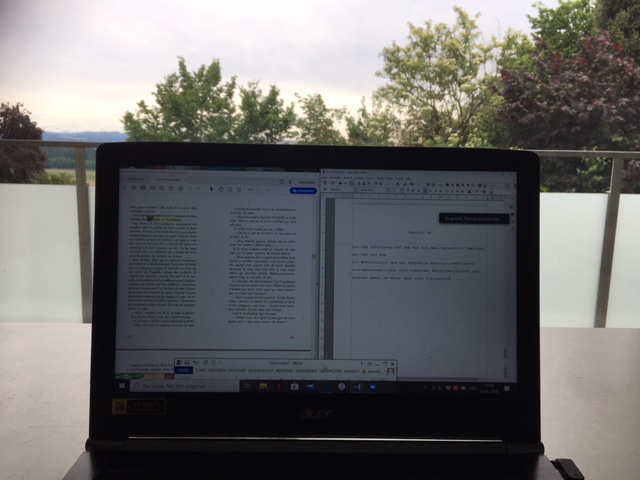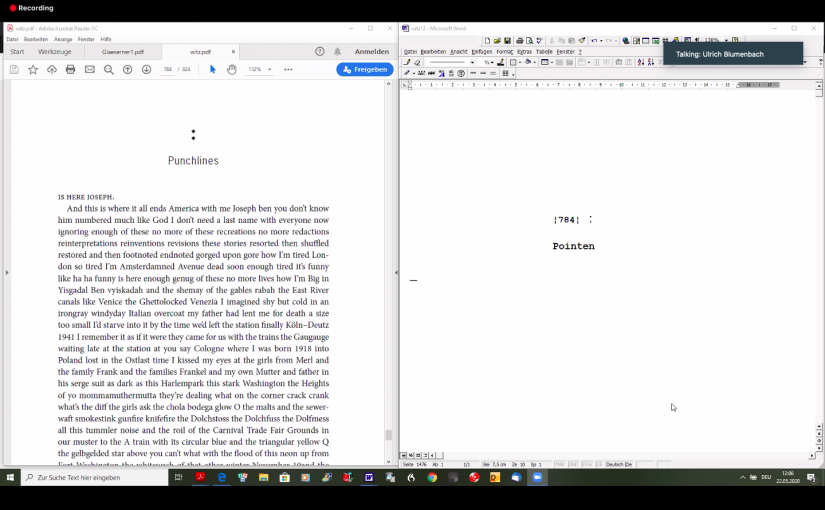Online Literaturtage in Zeiten der Pandemie und ein Gespräch mit Peter Bichsel, das passt nicht leicht zusammen. Denn Bichsel wettert gegen die digitalen Medien und den Virus zugleich. Das Verschwinden der Öffentlichkeit, das durch den Fortschritt der Digitalisierung im Gange sei, werde durch den Virus weiter vorangetrieben, sagt er gleich zu Beginn.
Dennoch trifft er sich mit Livio Beyeler zum Gespräch und wird über Kamera in die Wohnzimmer der Zuschauenden übertragen. Diskutiert wird sein Text Die drei Niederlagen des Denkers. Publikumsfragen werden dem technologiekritischen Bichsel über die Instagram-Seite des «Resonanzraums» zugespeist. Der kurze Text ist eine seiner Kolumnen aus den 60er-Jahren, die nun im Rahmen des Buchs Auch der Esel hat eine Seele gemeinsam mit anderen Kolumnen und frühen Texten veröffentlicht wurden.
Das Verschwinden der Öffentlichkeit
Darin schildert Bichsel das Gespräch zwischen einem älteren Bahnarbeiter – dem Denker – und einem jungen Kunstschlosser in einer Beiz. Der junge Schnösel verpasst dem alten Denker im Gespräch drei Niederlagen, doch Bichsel schliesst mit dem Satz «[D]er Denker war dreimal unterlegen – dies sei zu des Denkers Ehre gesagt.» Etwas scheint ihn an der Langsamkeit des alten Denkers zu faszinieren, der seine Gedanken mühsam ausformuliert, aber auch dem jungen Schnösel zuzuhören vermag – und ihm sogar Recht gibt. «Ein Denkender und ein Wissender, das sind zwei verschiedene Dinge», betont er im Gespräch mit Livio Beyeler, und viele denken heute zu schnell, fügt er an. Er schwärmt von stundenlangen unnötigen Diskussionen, die es früher gegeben habe, und die heute durch das schnell gezückte Smartphone verunmöglicht würden. Und er beklagt das Verschwinden der Beizen und der «Höckeler», die in ihnen verweilen und das Sujet seiner Kolumne bilden. Mit ihnen verschwinde die Öffentlichkeit und ohne Öffentlichkeit könne eine Gesellschaft nicht funktionieren, sei auch die Demokratie in Gefahr. «Einen der letzten gesellschaftlichen Begegnungsorte stellt der öffentliche Verkehr dar», klagt er und schliesst an: «Wir sind zu einer Grill- und Partygesellschaft geworden.» Untrüglich hat sich mit der Zeit ein gewisser Kulturpessimismus, den bereits der Text aus den 60ern aufweist, bei Peter Bichsel verstärkt. Dies erkennt er im Gespräch selbst an und schickt prophylaktisch voraus: «Natürlich war früher nicht alles besser. Jeder weiss, dass das nicht stimmt.» Dennoch scheint er selbst einer verlorenen Vergangenheit nachzuhängen. Inzwischen hat der 85-jährige Peter Bichsel die Schriftstellerei aufgegeben. Auf die Frage Beyelers hin, ob mit dem Schreiben wirklich Schluss sei, antwortet er denn: «Ich möchte nicht in ein Altersgeleier hineinrutschen. Ich möchte nicht von mir hören, dass es früher besser war. Und wenn ich weiterschreibe, hören die Leute das von mir.» Erzählen sei ein sentimentales Geschäft, es sei romantisierend und nostalgisch. Das lässt sich für Bichsel nicht verhindern. Um nicht kulturpessimistisch zu schreiben, hört er mit dem Schreiben auf. Da drückt der Kulturpessimismus umso stärker durch, gleichzeitig zeugen seine Aussagen von erstaunlicher Selbstreflektion.
Alternde Denker
Es ist frappierend, wie die Erzählsituation seiner Kolumne «Die drei Niederlagen des Denkers» in seinem Gespräch mit Livio Beyeler gespiegelt wird. Der eine jung, agil und wortgewandt, der andere alt, weise, aber umständlich um Worte kämpfend. Fast so, als habe sich Bichsel in den 60er Jahren in der Figur des alternden Denkers vorweggenommen, der zwar wenig galant spricht, dessen Worte dennoch hängen bleiben und tiefe Auseinandersetzungen offenbaren. Genau so wie der von ihm beschriebene, ideale Denker spricht er langsam, formt seine Gedanken geduldig und schweigend aus, antwortet dann knapp, und beantwortet die Fragen indirekter, doch auch tiefgründiger als erwartet. Mit dieser Andacht verwehrt sich Bichsel den Ansprüchen eines einstündigen intellektuellen Schützenfests. Doch sein Gespräch ist keineswegs eine Niederlage, gekonnt bringt er seine gut überlegten Antworten in der knapp bemessenen Zeit unter. «Kunst ist eigentlich so schwer, dass man sie heute überhaupt nicht mehr lernen kann», sagt der alte Denker im Text. Auf Beyelers Frage an Bichsel, ob sich die Erzählkunst denn heute noch lernen lasse, antwortet dieser stoisch: «Um es mit Karl Valentin zu sagen: ‘Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit’.» Ein Grund mehr für ihn, sich aus der anstrengenden Künstlerarbeit zurück zu ziehen. «Jetzt lese ich halt wieder», fügt er zum Schluss schmunzelnd an.