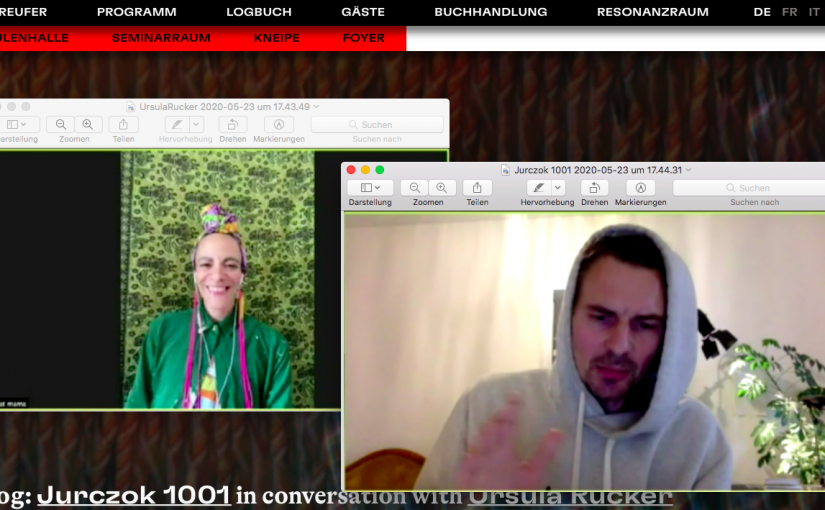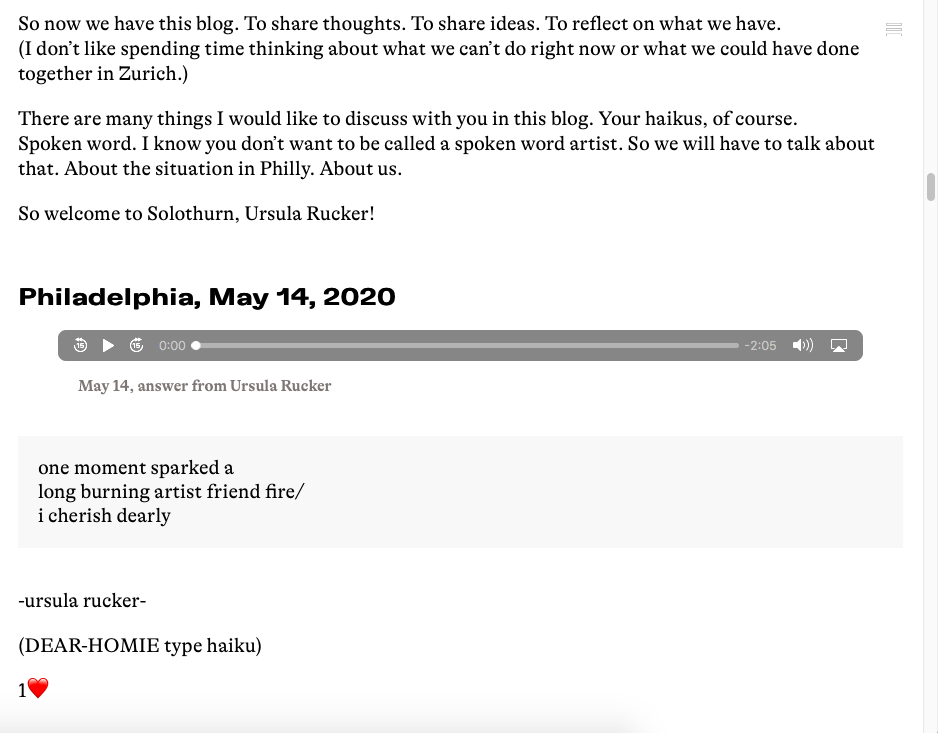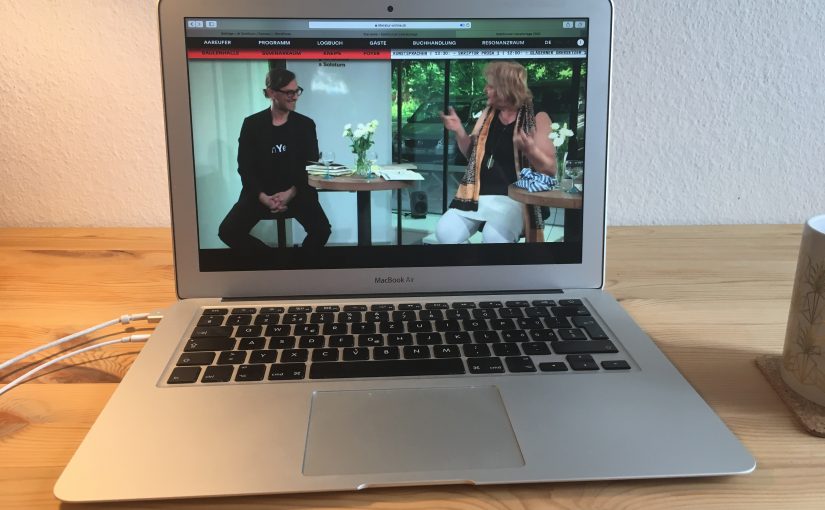Christoph Höhtker, in deinem neuen Roman Schlachthof und Ordnung stellst du die Menschen unter die Wunderdroge Marazepam. Im Ernst, wäre die Welt so nicht vielleicht besser?
Natürlich ist es für meine Begriffe keine gangbare Alternative, die Leute chemisch zu beeinflussen. Es ist aber letztendlich so, dass auf der ganzen Welt Drogen- oder Medikamentenkonsum gang und gäbe ist; es gehört zum normalen Alltag und ich stehe dem nur moderat kritisch gegenüber. Ich habe da keine ideologischen Schranken. Wenn man das jetzt auf die gesamte Menschheit hochrechnet… [lacht] Naja, man könnte sagen, dass die Menschheit momentan nicht in allerbester Laune ist und wenn die ein bisschen gehoben würde, wäre das vielleicht auch mal ganz angebracht. Letzendlich sind das globale Fragen von grosser Tragweite, die in so einem Buch nicht wirklich behandelt werden können. Für mich ging es darum, dass eine Droge, die auf jeden Menschen unterscheidlich wirken kann, ein sehr gutes Instrument ist, um viele verschiedene Szenarien durchszuspielen.
Du hast neben Drogen auch schon den Weltkommunismus als einzig gangbare Lösung erwähnt.
Also wenn man den Grundkern dieser Ideologie zu definieren versucht, ist das eine relativ rationale Analyse von Wirtschaftsgeschehen. Diese Form von Rationalität ist natürlich etwas, was gerade in pandemischen Zeiten durchaus mal verloren gehen kann. Insofern wäre Vernunft in Kombination mit Gerechtigkeit schon mal ein guter Ansatz, um die Welt zu organisieren. Andererseits glaube ich, und das ist in meinen Augen das zentrale Argument, dass der Kapitalismus keine wirkliche Ideologie ist, sondern etwas, was wesentlich näher am Kern des Menschen dran ist. Er ist eine menschliche Bedürfnisstruktur. Insofern glaube ich, ist der Kapitalismus dauerhaft schwer zu überwinden.
Der Roman ist voller Ideologien; du hast alles reingepackt, was geht.
Da wird mit vielen Ideologien gespielt, ja. In meinen anderen Büchern ist es auch so, dass politische Versatzstücke immer wieder benutzt werden. Die kann man natürlich auch humoristisch auswerten, nichtsdestotrotz haben sie aber immer einen relativ ernsten Kern.
Das speist sich bestimmt auch aus deinem soziologischen Interesse. Gestern im Gespräch mit Tom Kummer hast du diesbezüglich ein bisschen tiefgestapelt: Du sagtest, du hättest Wissenschaft nie ganz verstanden, würdest aber diese pseudowissenschaftlichen Belege lieben, die du in deinem Buch verwertest.
Damit meinte ich natürlich Folgendes: Ich stamme ja aus Bielefeld. Bielefeld ist ein sehr bekannter Soziologie-Standort. Zeitweise habe ich auch da studiert, aber mein Hauptstudium hab ich in Hamburg absolviert. Bielefeld ist berühmt für eine ganz bestimmte Schule der Soziologie: die Systemtheorie. Und wer etwas mit Bielefeld und Soziologie assoziiert denkt an den Namen Luhmann. Ich hab ihn natürlich gelesen, aber das sind schon sehr komplexe Theoreme. Deswegen habe ich gesagt, dass ich nicht sicher bin, ob ich da solide Verständnisgrundlagen habe. Das möchte ich mir nicht anmassen, zumal es auch schon sehr lange her ist.
Hast Du Dir mal überlegt Theaterstücke zu schreiben? Der neue Roman wirkt ja durchaus wie ein postmodernes Fragmentstück.
Ja, das würd mich nicht stören, wenn das Buch als Theater inszeniert würde. Es war natürlich meine Intention, Dinge, Szenarien, Stile zusammenzumischen und konventionelle Romanstrukturen bzw. Macharten postmodern oder postpostmodern aufzubrechen. Das mache ich gerne! Mit Theatertstücken habe ich mich bisher noch nicht so sehr auseinandergesetzt, wär aber auch gut. Das Problem ist die Zeit. Ich kann mich nicht einfach irgendwohin setzen und etwas produzieren, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Schubalde bleibt, extrem hoch ist. Da muss ich mir vorher sehr gut überlegen, ob ich dieses Risiko eingehen will. Wenn mir jemand sagen würde, er inszeniere an der Volksbühne und brauche ein Stück, würd ich mir das natürlich überlegen. Das Theater ist faszinierend, aber eine Welt, mit der ich nicht sonderlich vertraut bin.
Das ist interessant, denn es wirkt so, wie wenn du dich da zuhause fühlen würdest. Dieser innere Monolog des Junkies auf dem Weg zu Dr. Bunnemann beispielsweise ist grandios.
Jajajaja! Dieser Typ, Joachim Angélique Gerke… [kichert vor sich hin]
Ich sehe, du hast Spass.
Ja, der ist schon echt irre. Für mich ist diese Figur ein Sprachexperiment. Der Typ ist für meine Begriffe der sprachliche Extremstvertreter in dem Buch. Diese sehr kurzen Sätze, diese Assoziationen, diese Wortspiele, diese Kombinationen… der hat’s echt drauf. Ich habe nach Schlachthof und Ordnung noch einen Text geschrieben, in dem er alleine ist. Nur dieser Typ mit dieser Erzählweise, die noch wilder und extremer geworden ist. Dieses Buch wird wahrscheinlich niemals veröffentlicht werden.
Doch, unbedingt!
Nene, für sowas werde ich niemanden finden.
Deine Sprache ist überbordernd, sprudelnd, so breit, dass man sie nicht einordnen kann. Machst du das bewusst, oder passiert dir das?
Das ist bewusst. Diese Wortspiele fallen mir einfach ein. Wenn ich gut gelaunt bin und 2000 Kaffee getrunken habe, fällt mir sowas ein, aber das Spiel mit verschiedenen Sprachebenen, Stilen, Slangs, das ist schon ein zentrales Merkmal der Komposition – wenn ich das so sagen darf – von Schlachthof und Ordnung. Das ist bewusst. Es bereitet mir unheimliches Vergnügen, unterschiedliche Dinge in so einem gemischten Salat zusammenzumixen. Viel mehr, als wenn eine Linie so durchgehalten wird. Wobei ich es auch gut finde, wenn Leute das so machen, wie Tom Kummer zum Beispiel. In meinem neuen Text habe ich jetzt jedoch nur einen Sprachstil durchgehalten. Ich wechsle das immer. In Schlachthof und Ordnung kann auf jeder Seite etwas ganz anderes passieren. In meinem neuen Text ist es so, dass eine erwartbare Sache bis ins Manische übertrieben wird. [lacht] Ich mag es, den Leser ein bisschen zu nerven.