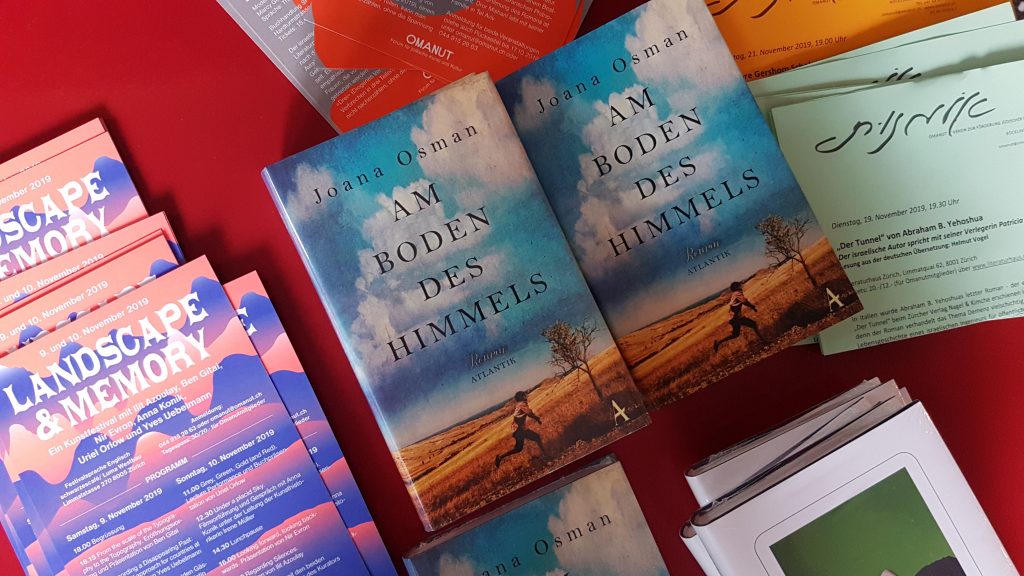Die Lesung der Nominierten für den diesjährigen Schweizer Buchpreis zieht so viele Besucher*innen an, dass der Saal des Literaturhauses bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Zum Glück finden sich für uns noch zwei Klappstühle, auf denen wir Simone Lappert, Ivna Žic und Tabea Steiner aus nächster Nähe sehen können – und vor allem hören. Denn was die drei Werke verbindet, sei der eigenwillige Klang ihrer Sprache, so Isabelle Vonlanthen, die die Lesung zusammen mit Martin Zingg moderiert.
Nach den Lesungen ausgewählter Passagen stellt Isabelle Vonlanthen die Frage nach den klanglichen Elementen und dem Rhythmus, welche die Werke der drei Nominierten auszeichnen. „Ich schreibe mit den Ohren“, erläutert Simone Lappert. „Die Bedeutung des Wortes ist ja immer im Klang schon enthalten, wenn wir etwa an «krachen» denken, oder «Schnee».“ Sie lese sich ihre Texte darum immer wieder vor, um sie vom Blatt in den Raum zu holen und auf ihren Rhythmus zu prüfen. Bisweilen lasse sie sich den Text auch von jemand anderem vorlesen, damit sie sich den Text nicht „schönlesen“ könne, fügt sie lachend hinzu.
Auch für Ivna Žic, die viel für das Theater schreibt und darum dem gesprochenen Wort eine grosse Bedeutung zuschreibt, leben Texte von ihrem Klang: „Man muss die Texte gerne in den Mund nehmen.“ Sie hört beim Schreiben jeweils Musik. Der Rhythmus der Musik helfe ihr, einen Rhythmus der Sprache zu finden.
Tabea Steiner versammelt in ihrem Roman Balg ein ganzes Kabinett verschiedener Figuren im dörflichen Raum. Sie nähert sich ihnen über das Vorlesen deren individuellen Stimmen: „Ich frage mich dann, kann es sein, dass diese Figur so spricht?“ Sie müsse bei jeder Figur das Gefühl haben, dass die jeweilige Stimme passe.
Manchmal können sich die Figuren geradezu gegen eine Sprechstimme sträuben und insbesondere auch gegen einen Namen, den man ihnen aufdrängen will, ergänzt Simone Lappert. Es gebe aber durchaus Figuren, deren Namen von Anfang an feststeht, sagt Tabea Steiner. So etwa sei es ihr mit „Timon“ ergangen.
Das wiederholte Vorlesen ausgewählter Passagen – auch bei Lesungen wie dieser – habe ihren Blick auf den eigenen Text durchaus verändert, sind sich alle drei Nominierten einig. „Inzwischen wähle ich für die Lesungen oft andere Passagen aus als zu Beginn“, sagt Steiner. Simone Lappert schliesst sich dem an und fügt hinzu, dass sie ihre Vorlesetexte sogar teilweise verändert habe. „Beim Vorlesen habe ich manchmal gemerkt, dass es mündlich irgendwo holpert – und habe die Passage dann angepasst“ Ivna Žic fügt hinzu: „Der Text wird einem nach den vielen Lesungen fremder und kommt zugleich auch näher.“
Die gemeinsamen Lesungen der Nominierten sind schon bald Geschichte. Bereits am 10. November werden wir im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals BuchBasel erfahren, an wen der Schweizer Buchpreis dieses Mal geht. Ob Balg, Der Sprung, Die Nachkommende oder aber Sibylle Bergs GRM – Brainfuck oder Alain Claude Sulzers Unhaltbare Zustände – bald schon erfahren wir, wessen „Klang der Sprache“ am meisten zu überzeugen vermochte.
Livia Sutter und Andrina Zumbühl