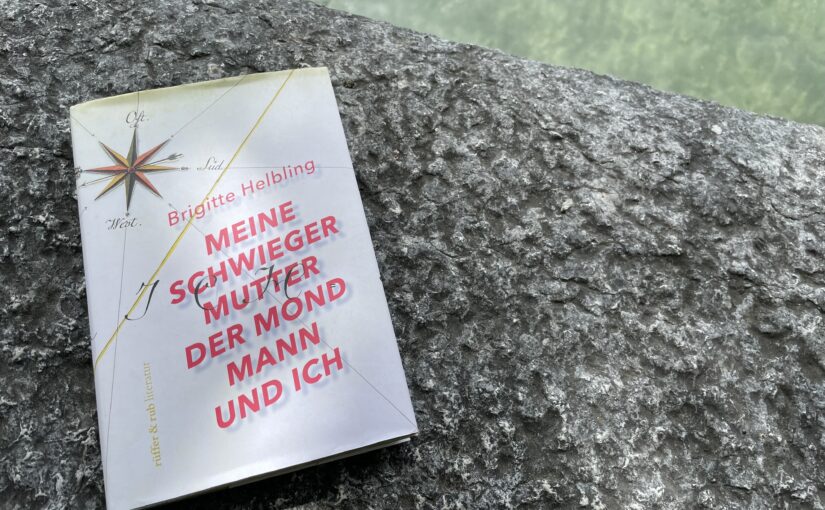L’auteur Pier Paolo Corciulo est à l’interview en ce samedi après-midi à Soleure. Nous parlons de son dernier livre, Le Cri des mouettes, publié aux Presses littéraires de Fribourg
D’où vous est venue l’envie, le besoin d’écrire Le Cri des mouettes ?
Cela part d’un moment que j’ai vécu, en 2015. J’étais hospitalisé, j’avais des soucis de santé, on a dû m’opérer de toute urgence. Et quand je me suis réveillé, j’avais des sons qui me parvenaient. Et j’avais l’impression que c’était des enfants qui se chamaillaient juste derrière l’hôpital. J’ai appris plus tard que c’était des mouettes… J’ai retranscrit ça sur un bout de papier et c’est à partir de là qu’est né Le Cri des mouettes. L’idée du narrateur amnésique est venue plus tard, mais là on est déjà dans la fiction.
Écrire pour vous, c’est un besoin ? Une nécessité ?
Oui, c’est un besoin. C’est clair. J’ai toujours la tête qui part vers l’envie d’écrire. Même si pour moi, c’est encore un mystère, ça reste quelque chose de nouveau. J’ai commencé à écrire à l’âge de 15 ans, mais je n’étais pas du tout armé parce que je détestais lire. Puis j’ai eu une professeur au lycée qui m’a vraiment donné envie de lire, pas les grands classiques qui m’ennuyaient à mourir, bien que j’ai appris à les aimer plus tard. En fait, je n’étais pas encore prêt, je le dis dans Le Cri des mouettes : c’est comme si on donne un repas gastronomique à un nouveau-né. Ça ne se fait pas, je n’étais pas prêt.
Finalement, vous avez commencé par écrire avant même de lire ?
Oui, grâce à la musique. J’adorais la musique française, la musique italienne. Et j’ai commencé à écrire par rapport à des textes que j’écoutais. Pourtant, assez vite, je me suis rendu compte que j’étais super limité, parce que je n’avais pas le bagage littéraire. Et c’est en découvrant Des Souris et des hommes de Steinbeck, mon bouquin de référence, que je me suis dit qu’on pouvait écrire ce genre de littérature. Il n’y a pas besoin d’écrire à la façon de Molière, de Hugo, on peut se laisser aller, vers quelque chose de plus décomplexée.
Dans le roman, l’histoire se déroule dans deux lieux bien définis, Neuchâtel et un petit village de pêcheurs du sud de l’Italie. On remarque assez vite le parallèle avec vous… C’est important, de placer les protagonistes de votre fiction dans des lieux que vous connaissez, que vous aimez ?
Je voulais rendre hommage à mes racines. Mais je ne voulais pas le faire, enfin j’espère que je ne l’ai pas fait de façon trop mielleuse, avec un thème qui peut vite tomber dans la mièvrerie. Je suis né à Neuchâtel, j’allais en vacances dans le sud de l’Italie avec mes parents. Quand j’étais ado, j’étais considéré comme un Italien en Suisse, et quand j’allais en Italie, on nous disait « ah voilà les Suisses qui arrivent ». Quand on est adolescent, on ne sait pas où on est, on se cherche encore, et je me demandais qui j’étais vraiment. Ce rapport à l’identité était important. Avec les années, j’ai fait la paix avec tout ça. Je sais que je suis les deux. Mais à un moment donné, être les deux c’est comme si on ne vivait qu’à moitié. J’avais besoin d’explorer ce passage. Comme j’ai fait la paix avec cette histoire, c’est le moment de parler de mon identité, de mes origines. J’ai donc pris ce narrateur comme alter-ego. Mais dans tous les livres, on parle de soi. Parfois on arrive à déguiser, parfois c’est plus flagrant.
On ne peut pas aller au-delà de nous-même dans les livres ?
Vous savez, c’est mon quatrième livre, avant j’avais fait des polars. Mais au fond, je parlais déjà de moi, mais de façon plus déguisée. Dans Le Cri des mouettes, j’avais envie de m’approcher de moi-même. Ce n’est pas une question d’égocentrisme, enfin peut-être que tous les écrivains sont égocentriques. Je n’écris pas pour rendre la réalité limpide. J’écris par réalisme, pas par réalité. Et c’est deux choses différentes.
Votre livre est une quête d’identité. Une façon de chercher l’apaisement ?
Oui, il y a de ça. Bien sûr, je ne l’ai pas écris pour faire la paix avec moi-même, ça je n’y crois pas. Si tu veux une thérapie, tu vas chez le psy… J’ai plutôt fait la paix avec moi-même et ensuite j’ai eu envie d’écrire quelque chose sur mon histoire. Albert Camus disait : mon pays, c’est la langue. C’est ce que j’aime, avant d’écrire une histoire : j’aime travailler sur le style.
C’est lui qui induit mon histoire, non l’inverse.
Blaise Ndala disait hier à Soleure, lors de la lecture de son roman Dans le ventre du Congo, qu’un romancier est un peu comme un Dieu dans un univers qu’il crée de toutes pièces. Vous ressentez cela en écrivant ? Cette ivresse de pouvoir faire subir à vos personnages ce que vous voulez ?
Bien sûr, écrire est jubilatoire ! Je n’irai pas jusqu’à me comparer à Dieu, même dans l’univers restreint que je m’impose. Pour moi l’écriture est un mystère, et je n’arrive pas à donner de définition claire, car je tombe dans le paradoxe. Certains disent : écrire c’est s’évader. Et moi non, c’est plutôt me retrouver. Mais c’est toutes ces contradictions qui font que la littérature est belle. Donc je n’aime pas donner de définition précise, parce que d’un bouquin à l’autre on peut complètement changer de vue, d’angle de vision par rapport à ce qu’on écrit.
Le jeu, vous le retrouvez en écrivant ?
On passe des moments compliqués, on travaille sur une demi-page pendant trois ou quatre jours, et on se dit que c’est mauvais. Des remises en question, de l’incertitude. Ça arrive tout le temps. Malgré cela, ça reste un jeu. Je ne vis pas de mon écriture, donc autant y aller avec plaisir.
On peut dire que vous n’êtes pas très tendre avec vos personnages, ils subissent des épreuves difficiles. Malgré tout, votre roman contient un grand message d’espoir. C’est une morale qui vous plaît, que malgré tout ce qui peut nous arriver, il y a toujours une lumière au bout du tunnel ?
Je voulais absolument finir ce roman par une note positive, car les personnages sont tourmentés. On parle du deuil, on confronte deux personnages qui vivent des deuils compliqués, l’un depuis un an, l’autre depuis trente ans. Qui va sauver l’autre ? Et finalement ce n’est ni l’un ni l’autre, mais la poésie. C’est ce message que je voulais amener, je voulais terminer par une note positive. Cependant, dans mon prochain roman, où je parle à nouveau du métier d’écrire. Là, il n’y aura pas d’échappatoire, les personnages vont sombrer. Je suis contradictoire quand j’écris. Si dans Le Cri des mouettes, on partait de l’ombre pour se retrouver dans la lumière, ici ce sera l’inverse.
Votre roman est aussi une histoire de duos.
Dans ces rapports, je voulais explorer le silence. Je suis fasciné par ceux qui arrivent à retranscrire le silence. Hemingway et Steinbeck le font à merveille. Et tous les non-dits, qui font des ravages dans les relations. J’avais envie d’amener ça, dans les rapports notamment entre le narrateur et son père, qui ont passé toute leurs vies à ne pas se parler.
Vous rendez un bel hommage à Hemingway.
J’ai adoré Le Vieil Homme et la Mer, Les Neiges du Kilimandjaro. Lui et Steinbeck. Quand j’étais à l’hôpital, j’avais un recueil de nouvelles de Steinbeck et je l’ai adoré.
La poésie occupe une place centrale dans Le Cri des mouettes. On peut s’en sortir grâce à la poésie ?
Je pourrai vous donner deux réponses. Dans le roman, le vieux poète dit que la poésie n’a jamais aidé les gens à aller mieux. Par contre, à la fin, le narrateur dit que ce même vieil homme lui a sauvé la vie grâce à son recueil de poèmes. En moi, j’ai ces deux réponses. Mes écrits ne vont sauver personne, c’est sûr. Mais il y a des poètes, comme Raymond Carver… Ça me parle tellement que je me dis que je peux changer ma vision des choses grâce à la poésie. Rentrer dans quelque chose de plus personnel. Pouvoir se débarrasser de certains regrets, de certaines peines. Et je pense que la poésie peut prétendre à ça. Dernièrement, j’ai eu des courriers de gens qui ont lu Le Cri des mouettes, de gens qui ont connu le deuil. C’est une grosse responsabilité d’écrire, quand on a des retours comme ça.
Dernière question, concernant le titre. Comment vous est-il venu ?
Le Cri des mouettes… C’est venu instantanément. Dès les premières pages, c’était évident. Voilà, c’est venu comme ça. Et je suis fier qu’on ne l’ait pas changé. Car c’est un fil conducteur du roman, avec ces oiseaux qu’on retrouve à Neuchâtel, mais également dans le sud de l’Italie. C’est un pont entre ces deux endroits. Et quoi de plus beau que des ailes ?