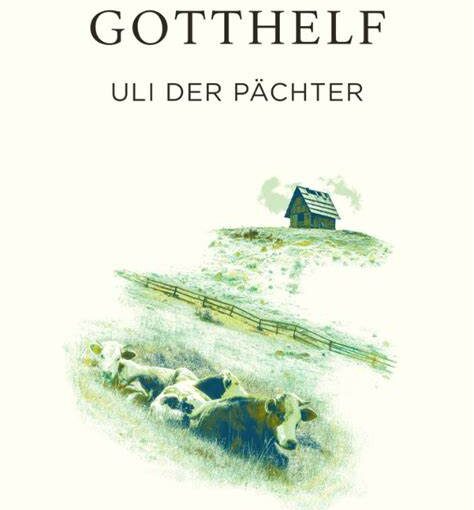Bei «Zürich liest» sprach Christine Lötscher mit Thomas Strässle, dem Mitherausgeber des Briefwechsels zwischen Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Die Besucher:innen erfuhren, wie es zur Veröffentlichung kam und welche Hindernisse es gab.
6. April 2011: Ein Tag, den Thomas Strässle nicht vergisst. Damals besuchte der Literaturwissenschaftler die UBS am Zürcher Bellevue. Er verfolgte, wie die historischen Dokumente aus der Dunkelheit des Safes von Frisch ans Licht geholt wurden. Welche Strapazen und Mühen ihn erwarten würden, konnte er noch nicht wissen. Es sollte ein langer Weg werden, bis der Briefwechsel sorgfältig ediert veröffentlich werden konnte.
Zwischen Neugier und Zweifeln
Für 20 Jahre waren die Briefe zwischen Frisch und Bachmann gesperrt. Seine Neugier zog Thomas Strässle direkt zum Briefwechsel. Beim Lesen seien ihm jedoch Zweifel gekommen: «Mich legitimiert eigentlich nichts, diese Briefe zu lesen.» Dazu kam aus dem Publikum eine kritische Frage: Woher er denn die Sicherheit genommen habe, die Briefe lesen und veröffentlichen zu dürfen. Thomas Strässle erklärte, er sei sich bewusst gewesen, dass er in eine Beziehungswelt eindrang, mit der er nichts zu tun hatte. Er habe die rund 300 Korrespondenzstücke als Vertreter des Max Frisch-Archivs lesen dürfen. Die Verantwortung, dass die Briefe von Ingeborg Bachmann veröffentlicht werden durften, trage er jedoch nicht. Entschieden hätten dies ihre Geschwister.
Die Sperrfrist als Hinweis für Frischs Wille
Was sprach für eine Veröffentlichung der intimen Geheimnisse von Frisch und Bachmann? Thomas Strässle nennt vier Gründe. Wenn Frisch gewollt hätte, dass die Briefe nicht gelesen würden, dann hätte er sie vernichtet. Es sei kein Beweis, dass Frisch sie habe publizieren wollen, aber ein Hinweis. Zudem hätten sowohl Frisch als auch Bachmann ihre Beziehung literarisch verarbeitet. Einen ersten Schritt zur Veröffentlichung hätten die beiden also selbst getan. Die zwei Literat:innen seien zudem Personen öffentlichen Interesses. Darüber hinaus rankten sich um ihre Beziehung viele Mythen, die in den Briefen widerlegt würden. Max Frisch als alleinigen Täter zu sehen, greife zu kurz.
Beziehung wurde nicht «zu Literatur verwurstet»
Durch den Briefwechsel werden laut Thomas Strässle folgende Korrekturen ersichtlich: Das bisherige Narrativ, dass Frisch Bachmann für eine jüngere Frau verlassen hätte, stimme so nicht. Ausserdem könne man nicht mehr behaupten, dass in Mein Name sei Gantenbein intimste Details der Beziehung ohne Einverständnis von Bachmann ausgeschlachtet wurden. Die Schriftstellerin hat den gesamten Schreibprozess begleitet und auch die allerletzte Fassung abgesegnet.
Wichtig sei, dass man nun nicht in Anschuldigungen gegen Bachmann verfalle. Generell müsse man sich von der Vorwurfsrhetorik verabschieden.
Verhandlungen mit den Geschwistern Bachmann: «lang, herausfordernd und unangenehm»
Nach Ablauf der Sperrfrist begannen die Verhandlungen mit Ingeborg Bachmanns Geschwistern. Um auch ihre Briefe veröffentlichen zu können, brauchte es nämlich deren Einwilligung. Die Verhandlungen seien langwierig und herausfordernd gewesen, mehr noch: «Es war unangenehm.» Es dauerte zwei Jahre, bis die Geschwister überhaupt zu einem Gespräch mit Strässle bereit waren. Zuerst wollten sie, dass nur Frischs Briefe veröffentlicht würden. Doch das kam für ihn nicht in Frage. Schliesslich kam man zusammen mit dem Suhrkamp Verlag zum Beschluss, bis zu welchem Zeitpunkt der gesamte Briefwechsel erscheinen sollte.
«Ich liebe es, den Film von Margarethe von Trotta zu polemisieren»
Während des 1.5-stündigen Gesprächs teilte Thomas Strässle mehrfach gegen den neuen Film von Margarethe von Trotta aus. Vor zwei Wochen erschien der Spielfilm Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste. Er behandelt das Leben der Schriftstellerin und die Beziehung zu Max Frisch.
Strässle hatte mit dem Filmprojekt zu tun. Die Regisseurin wollte den Briefwechsel einsehen. Doch er erlaubte das nicht. Die Briefe waren noch streng geheim, und Stillschweigevereinbarungen mit 70 Leuten abzuschliessen, wäre ihm zu riskant gewesen. Es sei ein harter Kampf gewesen und auch um viel Geld gegangen. Ins Detail wollte Strässle nicht gehen. Er selbst habe den Film nicht gesehen und möchte dies auch nicht tun. Gespräche und Kritiken würden aber darauf hinweisen, dass der Film die alten Mythen, Klischees und Legenden reproduziere. Im veröffentlichten Buch sei die Korrektur zu finden.
Gegen Ende des Gesprächs kam eine Publikumsfrage zur zweiten Ehefrau von Max Frisch. Wie sie zur Veröffentlichung des Briefwechsels stehe. Strässle antwortete kurz und knapp: «entspannt». Dabei konnte er sich einen letzten Seitenhieb gegen den Film nicht verkneifen. Er habe Frischs Ehefrau versichert, dass sie vom Briefwechsel nichts zu befürchten habe. Beim Film sei das anders. Dort werde sie gar beim falschen Namen genannt.
Abgleiten in die Psychologie
Was lässt sich alles aus den Briefen herauslesen? Und wo läuft man Gefahr, zu viel hineininterpretieren zu wollen? Dem Briefwechsel steht ein umfangreicher Kommentar zur Seite. Es sei wichtig gewesen, alles zu erklären und historische Hintergrundinformationen zu geben, erklärte Thomas Strässle. So würden Lücken nicht willkürlich ausgefüllt.
Doch Thomas Strässle erlaubte sich auch psychologische Deutungen: «In der Beziehung war Frisch verzweifelter und hat mehr gelitten. Doch Bachmann ist mit mehr Beschädigungen herausgekommen.» Spricht hier der Literaturwissenschaftler oder ein Hobby-Psychologe? Inwiefern lässt sich aufgrund der Briefe auf die gesamte Liebesbeziehung zwischen Frisch und Bachmann schliessen? Sind sie nicht bloss ein kleiner Teil? Dass er sich hier fernab seines Fachbereiches bewegt, bemerkte der Literaturwissenschaftler und schloss sein Statement mit: «Ich bin kein Psychologe.»
Es blieb aber nicht die einzige Situation, in der er in die Psychologie abglitt. So etwa, als Strässle erzählte, wie Frisch auf das Geständnis reagierte, dass Bachmann eine Beziehung mit einem anderen Mann führte. Obwohl in ihm ein Gefühlschaos herrschte, habe Frisch glasklar formuliert. Das sei keine Reaktion eines «tobenden Eifersuchtsweltmeisters», sondern eines Menschen, der «den emotionalen Zustand rational zu durchdringen versucht». Christine Lötscher unterband diese Interpretationen nicht etwa, sondern fügte sogar noch eigene hinzu, wie zum Beispiel: «Wenn wir wieder zur Psychologie zurückkehren. Vielleicht war ja auch die Berühmtheit ein weiterer Grund für die psychische Verfassung gegen Ende von Bachmanns Leben.» Heikles Terrain.
Interessant war der Abend allemal: Das Publikum erhielt einen Einblick in die 10-jährige Arbeit bis zur Veröffentlichung und einen neuen Blick auf eine einzigartige Liebesgeschichte. Es bleibt jedoch die Frage, wie weit ein Briefwechsel eine Beziehung ausleuchten kann.