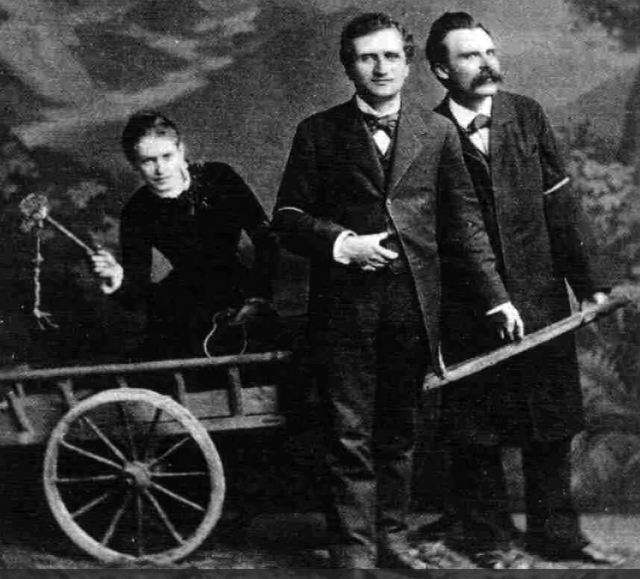Eng ist es. Eng sind die Bücher, Magazine, Kartenständer und Stühle aufgestellt. Nur die Menschen stehen nicht eng aneinander. Drei junge Freunde sitzen im Hintergrund auf bequemen Sesseln und sehen aus, als wären sie in ihrem Wohnzimmer. Einfach toll so eine Buchhandlung. «Paranoia», so der Name, ist hier nicht Programm. Zum Glück. Es ist vielmehr sehr heimelig und liebevoll. ‹Cozy› würde man in einem Blog schreiben. Was ich ja versuche.

Hier liest heute Jörg Rehmann aus seinem Debütroman «Herr Wunderwelt» vor. Seraina Kobler, die Moderatorin der Lesung, wirkt ein bisschen nervös (ich übrigens auch), aber das wird sich legen. Sie eröffnet den Abend mit der lockeren Einstiegsfrage, was den das Lieblingsessen aus den Jugendtagen von Jörg Rehmann sei. «Fischlefunker» (so spricht man es aus), eine Suppe aus Lebkuchen, die es nur an Weihnachten von der Oma gab, so die Antwort vom Autor. Schnell wird klar, allzu formal wird das hier heute nicht. Gut so.
Herr Rehmann beginnt aber bei der Form des Romans. Dieser hat zwei Erzählstränge, die ineinander verschlungen erzählt werden. Da sind die Kinder- und Jugendjahre von Dirk Sehmann, dem Hauptprotagonisten und Ich-Erzähler, die von den Eigenheiten der Adoleszenz in der DDR berichten. Der zweite Strang erzählt die Jahre ab der Flucht von Dirk nach Westberlin mit 23 und sein wWandeln zwischen der Alltagswelt und dem Nachtleben in der Queer-Szene. Es soll kein Schelmenroman sein, so Rehmann, aber der Protagonist Dirk hat etwas schelmenhaftes an sich. Er angelt sich ein Job als Pfleger in einer Altersresidenz, ohne die notwendige Ausbildung abgeschlossen zu haben. Immer wieder flüchtet Dirk in erfundene Biografien und in seine Fantasie. «Herr Wunderwelt» ist deshalb ein passender Titel für den Roman.
Jörg Rehmann spricht mit ruhiger aber kräftiger Stimme. Er lacht viel. Im Publikum ist es still, nur mein Magen knurrt. Gut trinke ich Bier. Hat ja Kohlenhydrate, wie man weiss.
Man spürt, wie viel Zeit Jörg Rehmann mit der Figur Dirk verbracht hat. Zwischen den Leseblöcken erfahren wir einige Details, die so im Buch nicht zu lesen sind. Überhaupt gibt sich Herr Rehmann in den Lesepausen sehr offen und plaudert aus dem Nähkästchen. Zum Beispiel, dass im Buch kein ostalgischer Blick transportiert werden sollte. Es sei ein grosser zeitlicher Abstand zu den Geschehnissen notwendig gewesen, um die Geschichte mit Leichtigkeit und Humor zu schreiben, dennoch soll sie nichts beschönigen. Bei der abschliessenden Fragerunde zeigt sich das Publikum zurückhaltend. Mich würde dann noch interessieren, wie der Autor zu anderen Ostromanen wie zum Beispiel «Herr Lehmann» steht. Diesen hat er bewusst nicht vor Abschluss von «Herr Wunderwelt» gelesen, so Rehmann, aus Angst sich zu stark an ihm zu orientieren.
Seraina Kobler schaut auf die Uhr. 20 Minuten überzogen. Also Zeit abzuschliessen. Mein Arsch tut auch schon ein wenig weh.