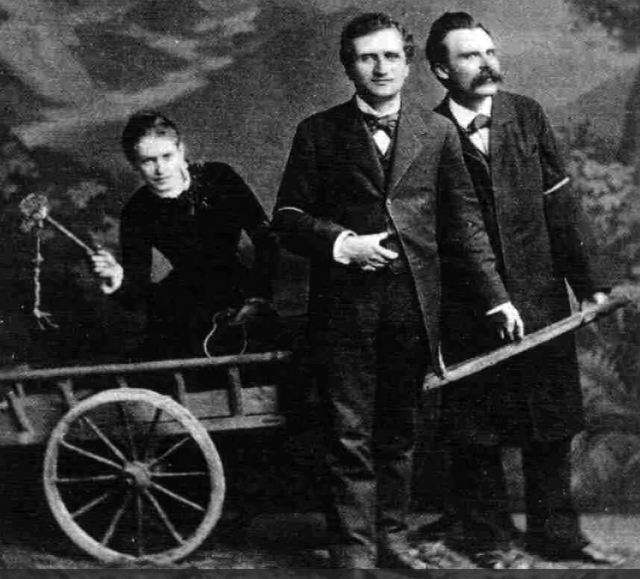Gut 50 Personen versammelten sich am Donnerstagabend in einem Bücherladen in der Nähe der Langstrasse direkt hinter den Gleisen des Zürcher Hauptbahnhofs. Sie sind gekommen, um Aline Wüst zuzuhören, wie sie Geschichten von Prostituierten in der Schweiz erzählt. Sie sitzt vor einer Glasscheibe, hinter der die Züge in und aus dem Bahnhof fahren. Während sich die Zuhörer*innen bis kurz vor Beginn gut gelaunt miteinander austauschen, spürt man eine erhöhte Anspannung im Raum, als Aline Wüst beginnt, vorzulesen. Im Raum wird es mucksmäuschenstill. Nur im Hintergrund hört man leise das Summen der Lüftung und das Quietschen der Gleise.
Ein Zug fährt vorbei.
Aline Wüst erzählt von ihrer Arbeit, wie sie Tag für Tag in verschiedenen Puffs verbrachte, um mit den Frauen, die dort arbeiten, zu reden. Sie wollte jene Menschen hören, deren Stimme in der Gesellschaft nicht gehört werden. Ein Zug fährt vorbei. Die Geschichten, die sie erzählt, gehen unter die Haut. Sie erzählt von Rumäninnen, Bulgarinnen und Ukrainerinnen, die in die Schweiz geschickt werden, – wahrscheinlich kommen täglich Frauen in der Schweiz an – um hier als Gastarbeiterinnen Geld zu verdienen. Oftmals treffen sie in ihrer Heimat einen Mann, der ein schickes Auto fährt. Ein paar Monate später befinden sich die Frauen in einer Beziehung mit den Männern und es kommt so weit, dass diese die Frauen auffordern, in der Schweiz auf den Strich zu gehen; etwas, was sich die meisten ein paar Monate vorher nicht hätten vorstellen können. Doch durch die vorgespielte Liebe der Männer und der lange anwährenden Manipulation sehen die Frauen diese Idee als eine vielversprechende Chance an. Ein unverständliches Kopfschütteln geht durch die Menge, als Aline Wüst erzählt, dass diese Männer das auf dem Strich verdiente Geld den Frauen zum grössten Teil abnehmen und die Männer dies nicht nur mit einer, sondern oftmals mit mehreren Frauen gleichzeitig machen.
Ein Zug fährt vorbei.
In der Schweiz wird von Frauen vieles abverlangt. Ob und inwiefern es sich bei der Prostitution um einen ‹normalen› Beruf handelt, bleibt eine aktuelle Kontroverse. Die diskursive Darstellung von bezahlter Sexarbeit in den Medien und der Politik produziert andere Anschauungen, Anschauungen die Prostitution unter demselben Paradigma einordnen, unter dem auch zum Beispiel Detailhandelsfachkräfte oder Reinigungsfachkräfte zusammengefasst werden. Doch das, was die Frauen machen, die sich prostituieren, sei nicht normal, meint eine Sexarbeiterin, die aus Bulgarien kommt und deren Stimme mittels Tonaufnahme im Raum abgespielt wird. Die Freier behandeln die Frauen manchmal eher wie Objekte als Menschen. «Natürlich nicht alle», meint eine andere Sexarbeiterin, doch man fragt sich auch immer, ob hinter den Aussagen nicht eine Art schützender Euphemismus die Realität verzerrt. Die Alternativen für die Frauen sehen nicht vielversprechend aus. Viele sind nach ein paar Jahren in der Prostitution psychisch kaputt und leiden dann zum Beispiel an posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Machtlosigkeit gesteht sich auch Aline Wüst ein, die ihre begrenzten Möglichkeiten dafür einsetzt, den Frauen zuzuhören und ihnen eine Stimme zu geben.
Ein Zug fährt vorbei.