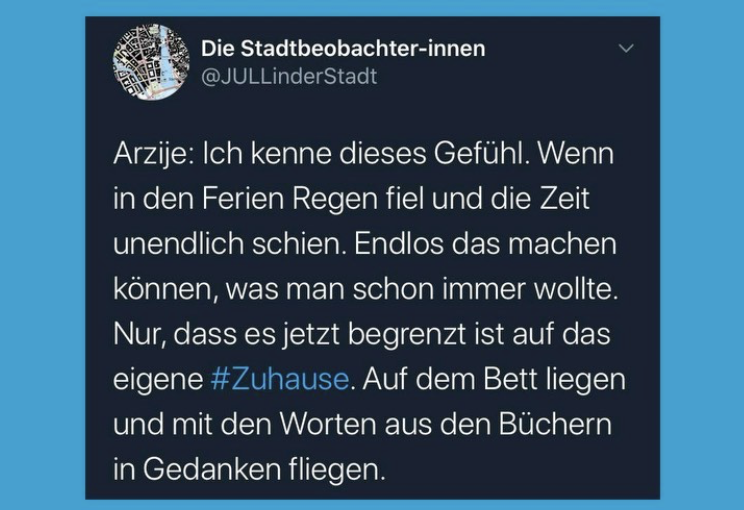Das «Playbook» eines American-Football-Teams schreibt allen Spieler*innen ihre Bewegungen auf dem Feld genau vor, damit sich die Mannschaft an die optimale Taktik hält. Das «Design Your Future Playbook» – kurz «DYF Playbook» – hat daher seinen Namen und soll Taktiken vermitteln, wie man Lebensprobleme aus dem passenden Winkel tacklen kann. Darüber verliert es aber keine langatmigen Paragraphen, sondern bietet Illustrationen, kurze Texte und vor allem viele Übungen, die zur Reflexion anregen.
Eine Mischung aus Übungsheft, Ratgeberliteratur und Optimierungsgedanke? Ich setze mich in die gut gefüllten Stuhlreihen der Buchhandlung Nievergelt, um das herauszufinden. Hinter dem «DYF Playbook» stehen Jean-Paul Thommen, Coach für persönliche Entwicklung und Dozent für Betriebsökonomie, sowie Michael Lewrick, der verschiedene Firmen in Innovationsfragen berät und Schulungen zu «Design Thinking» anbietet. Das «Design» im Buchtitel leitet sich von diesem Konzept her und, so erklärt Michael Lewrick, steht für eine Denkhaltung, eine Herangehensweise an schwierige Situationen: Sich intensiv mit einer Frage auseinandersetzen. Das zugrunde liegende Problem identifizieren. Es mit der passenden Strategie lösen.
Wie das «DYF Playbook» seine Spieler*innen an diese Denkhaltung heranführt, darf das Publikum gleich selber ausprobieren. Wir bekommen eine Kostprobe und üben uns in Selbstreflexion und kreativer Problemlösung. Ich bin skeptisch. Kann, soll man sein Leben behandeln wie ein Designprodukt? Macht es immer glücklich, gezielt zu wachsen? Darf das Leben nicht auch einfach wuchern? Nutzenmaximierte Lebensläufe zu produzieren sei nicht das Ziel des Buches, sagt Jean-Paul Thommen. Es soll vielmehr jede*n Einzelne*n dazu anregen, die eigene Handlungsfähigkeit zu entdecken, sich intensiv mit sich auseinander zu setzen und positive Veränderungen anzustossen.
Das Umfeld mit in diesen Prozess einzubeziehen, sei besonders wichtig, betonen die Autoren weiter: Veränderung kann im Vakuum nicht gut gedeihen. Gerade darum sei das «DYF Playbook« auch als Teamsport angelegt. Am besten also gleich auch ein Buch für eine*n Mitspieler*in kaufen. Diese Taktik geht auf und die Autoren können zum Schluss viele «Playbook»-Exemplare signieren. Das «DYF Playbook» scheint eine Fangemeinde in Zürich gefunden zu haben.