KW43
«Wehrhaftigkeit im Sprechen ist der erste Brocken vom Trost.»
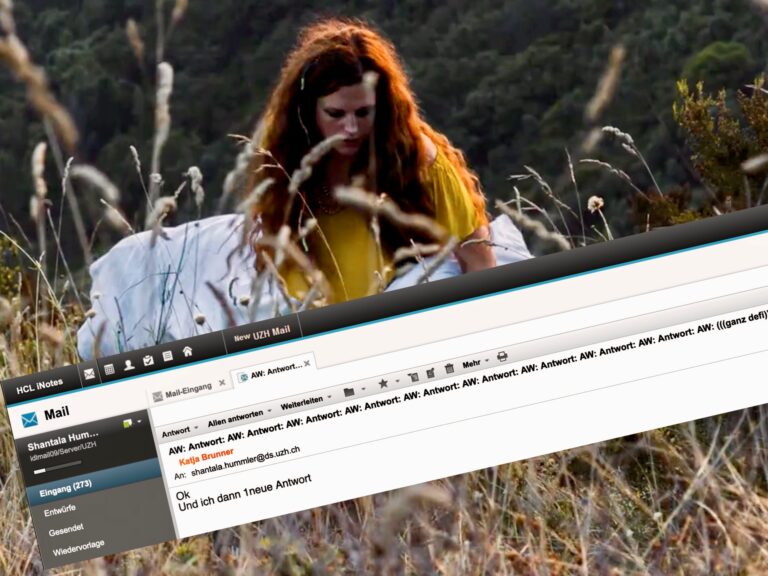
Morgen feiert Katja Brunner die Zürcher Vernissage ihres ersten Buches «Geister sind auch nur Menschen» im Rahmen von «Zürich liest». Wir haben vorab mit der namhaften Theaterautorin per Mail zwischen Berlin und Zürich über ihre Spoken-Word-Texte geredet. Ein Gespräch über die Obszönität des Trauerns, Mitgefühl als subversive Kraft und das sinnliche Wissen der Tragödie.
Katja, mit dem Band Geister sind auch nur Menschen veröffentlichst du zum ersten Mal ein Buch und zwar zwei deiner Theaterstücke als Sprechtexte. Wie verlief diese mediale Verschiebung vom Gesprochenen hin zum Schriftlichen?
Die Texte sind durchaus noch performative Texte, also, sie laut zu lesen, gibt ihnen Guzzi sozusagen. Konkret handwerklich habe ich teilweise den Sprachgestus verändert, ihn etwas stärker festgezurrt. Szenische Umsetzung braucht immer Lücken im Text und um ihn herum, die habe ich etwas verkleinert. Dem Motor der Texte bin ich treu geblieben. Theater ermöglicht eine sinnliche Erfahrbarmachung des Gesprochenen, wobei ein Moment im Vergleich zum schriftlichen Text besonders gewichtig ist: Die Latenz. Dass also in einem szenischen Raum immer umgegangen werden muss mit dem Nichtgesagten, dem Verborgenen. Am Theater ist mir eigentlich immer ganz lieb, dass es damit arbeitet, dass da eine Latenz ist. Es ist im Prinzip immer weniger offen als mensch denkt: Sprechen, bzw. zur Sprache zu gehen, entsteht über eine Art Latenzzwang. Dazu kommt ein paradoxer Rahmen: Sagen ungleich meinen. Das lädt die Körper auch mit auf, im Sprachgestus, wenn da so widersprechende Bewegungen im Text sind.
Der erste Text trägt den Titel Ändere den Aggregatzustand deiner Trauer – ein Imperativ also, eine Handlungsanweisung. Wie tue ich das, den Aggregatszustand meiner Trauer ändern?
Oh, wenn ich das wüsste. Leider habe ich keinen Schimmer, keinen Dunst, keine Dämmerung wie mensch den wirklich ändert, ich würde aber vorschlagen: Zu wissen, wo der Notausgang ist. Ich weiss nur, dass die Sprechinstanzen im Text durch diesen vielleicht langwierigen, aber uns mit dem Leben vereinenden Prozess hindurch gehen müssen. Des Trauerns, des Umgangs mit Verlust. Und dass sie diesem Prozess beikommen, indem sie mitunter auch sehr viel Stille aushalten, sich durch die abgebrochenen Teile hindurchwaten, Langsamkeit, Geduld, Knochen heilen schnell, Bänderrisse brauchen Geduld.
Ich vermute, er lässt sich ändern, indem mensch rundheraus akzeptiert, dass mensch einfach völlig Gesetzmässigkeiten unterworfen ist, die Gegebenheiten sind. Es gibt zwar immer Notausgänge, aber ich muss wach genug sein, sie mir zu merken. Und manchmal verpasse ich sie – wie Türen im Traum – und dann sind die übrigens so definitiv verpasst, dass es nicht revidierbar ist.
Und vielleicht: Zustände nicht wie im Panoptikum permanent kontrollieren, vermessen zu müssen. Das scheint mir auch zwielichtig, bzw. eine ambivalente Sache, denn den Aggregatzustand der Trauer permanent ändern zu müssen, ist ein Gebot der Optimierung, welches ich auch durchaus richtig deppert finde, aber natürlich arbeitet mensch gerne und fleissig an der Vermeidung gefährlicher Empfindungen. Es gibt im Prolog bzw. der Ansage zum Text die Behauptung, dass die Trauer eben ihren Aggregatzustand mehrfach geändert haben muss, bis sie sozusagen frei ist. Die Dauer also bis mensch den Ausgang findet, wenn mensch den Notausgang verpasst hat, sozusagen.
Trauer nimmt in deinem Text eine eindringlich körperliche Gestalt an, die ihre Triebhaftigkeit, Lust und dunkle Begierden ausstellt. Das zeigt sich in so raffinierten Wendungen wie ‹Befriedung›, über die man immer wieder stolpert, weil man ‹Befriedigung› mitliest. Ist Trauer im Grunde obszön?
Ich glaube, Trauern ist ein emanzipativer Akt, der die Rückkehr eines eminenten Verhältnisses zur Zeit bedeutet: Plötzlich kann man sich eine Zukunft vorstellen. Auch wenn sie schmerzhaft kodiert ist, denn etwas oder jemensch fehlt und das unweigerlich bestehenbleibende Fehlen dieser Person ist grausam. Ich vermute, dass ich alternative Bebilderungen zum Trauern finden wollte, nicht dieses Steine auf Grabsteine legen als Geste, nicht diese fahl weissen Kärtchen mit sinnigen Sprüchen, nicht das Urpapierne; steif dastehen bei der Verabschiedung, als wäre ein Mangel an eigener körperlicher Wachheit eine Anerkennung für die Toten. Sondern ich wollte sie körperisieren, sodass die Sprache ins Körperliche kippt, weil letztendlich Trauern ein massiv körperlicher Vorgang ist: Wir erkennen traurige Körper sofort. Wir erkennen missliche seelische Lagen in Körpern, erriechen sie quasi. Sie erinnern uns sofort der eigenen Schwere bei Trauer.
Zudem vermute ich irgendwo eine Schwelle, eine Art Schamschwelle beim Trauern: lieber ja nicht zu viel, lieber ja nicht Kontrollverlust, selbst wenn ein unerwarteter Tod Ursache ist. Nebst einer eventuellen Funktionsuntüchtigkeit der trauernden Person, die eh schnell auch marginalisierend einwirkt auf den/die Betroffene(n). Natürlich ist Trauer etwas höchst intimes, ein inneres Zwiegespräch, das warten auf Helligkeit vielleicht und natürlich gibt es für ihre Kanalisierung extrem viele anerkannte Rituale, aber zu denen steht mensch – so nicht voll gläubig – ja irgendwie stets in einer Ambivalenzposition. Es sind quasi für eine teilweise postreligiöse mitteleuropäische Zeit nicht mehr gefüllte Rituale.
Und vielleicht wird im Akt des Trauerns auch irgendwo gegen das Gesetz der Ersetzbarkeit massiv verstossen: Schliesslich trauern wir und wir trauern ganz spezifisch und präzise um diese eine Figur in unserer zeitlichräumlichen Gegenwart, die nur so war und so roch und so stand und so dies und das wollte. Wir beglaubigen mit unserer Trauer die absolute Unersetzbarkeit dieses Menschen und das ist vielleicht eine antikapitalistische Botschaft. Also, im Sinne von urkörperlich, dräuender Kontrollverlust (Scham alert) und Ersetzbarkeitsleugnung, in diesen drei Punkten ist Trauer womöglich obszön.
Wäre Literatur, genauer: dein Buch eine Form des «postreligiösen» Trauerrituals?
Gute Frage! Beziehungsweise tricky. Ich meine zu beobachten, dass es ja quasi eigentlich kulturell christlich ist oder kulturell jüdisch oder so ähnlich, wie wir uns dann halbwegs ritualisiert und institutionalisiert dem Trauern verschreiben. Gleichzeitig gibt es eine grosse Abkehr von fixierten Grabstätten: Die Friedhöfe stehen sozusagen wortwörtlich leer, obwohl logischerweise nicht weniger gestorben wird. Zulauf erleben dafür alternative Bestattungsformen, Luftbestattungen, selbstbestimmtes Ausstreuen an Lieblingswegen und so weiter. Es gibt jetzt aber nicht proportional dazu mehr Orte, an denen öffentlich Trauer gelebt werden könnte – fast so, als würde sich selbst sowas Unvermeidbares und in sämtlichen Leben Zustossendes wie Verlusterfahrung und die ganzen vielleicht auch sehr ambivalenten Implikationen von Schmerz ganz privat aushandeln lassen müssen. Mit W. H. Auden gesagt: «Private faces in public places are wiser and nicer than public faces in private places». Also müsste mensch wieder in der Kunst diesen Platz suchen, herstellen. Einen Ort erwachsen lassen, der vielleicht unter soziale Plastik liefe. Eine Plastik des Aushaltens. Für’s Aushalten. Die einen aushält. Mitten in der Stadt, das fände ich super. Wobei das auch einen Haken hat: Tode von berühmten Figuren können bekanntlich zu Massenansammlungen und Trauerdarlegungen öffentlichster Art führen. Das mag beinahe befremdlich sein, aber die Aufladung kommt ja von wo und der Umstand scheint mir dann fremdbesetzt zu werden, vereinnahmt.
In deinem Trauerspiel finden sich erwartbare, aber auch ganz überraschende Figuren, die du zur Sprache kommen lässt: Die Maden, der Tod, der Fuchs etc. Über diese Figuren bringst du u.a. ökologische, nicht-humane Themen und Perspektiven auf das menschliche Sterben und Trauern in den Text.
Definitiv. Es ging mir darum, Hemerophile zur Sprache kommen zu lassen – den Fuchs sowie andere, hier: absolut massgeblich an Zersetzung beteiligte Tiere. Ohne Ameisen gäbe es etwa keine Verwesung und gesamthaft sind sie auf dem Planeten schwerer als wir Menschen – das muss mensch sich mal vorstellen! Das irgend anklingen zu lassen oder subsubkutan mitzudenken, interessierte mich. Zudem wollte ich sie irgend märchentechnisch aufladen, sprich: Der Fuchs ist eine beredte Figur; Reineke Fuchs, der Wolf und der Fuchs, «Fuchs, Du hast die Gans gestohlen» etc. Dabei hatten davor die menschlichen Halter die Gänse schon von sich selbst gestohlen. Diese Anklänge vielleicht.
Und ganz konkret wäre mein Wunsch, dass eigentlich hoffentlich zwischen menschlichem Sprechen und tierischem Sprechen kein Unterschied mehr besteht. Den Menschen etwas mehr dort einzureihen, wo er ist: Ein Trockennasenaffe. Ein Säugetier. Und das Sterben als Lebensgrundlage für Tiere, die für den Fortbestand der Erde Funktionen erfüllen – ganz im Gegensatz zum homo sapiens sapiens.
Plus auf einer rein formalen Ebene wäre noch anzumerken: Das Epizentrum des Texts ist ja dieser Junge, der den Freitod wählte. Deshalb wollte ich Motive aus der Kinderwelt verwenden und bestenfalls etwas paradox aufladen: Die Alte ‹böse› Frau, die mit dem Stock herumschlägt (böse Hexe, Stiefmutter etc.), die mensch hier eigentlich in Sorge um die Beschaffenheit der Gegenwart erlebt. Darin reiht sich auch der sprechende Fuchs, der jetzt hier aber als im urbanen Raum lebender Zeitgenosse Stadtbetrieb reflektiert wird; die Maden, die sich über ihre zunehmende Arbeitslosigkeit beschweren, da weniger gestorben würde.
Genauso bemerkenswert ist eine Leerstelle: der Mann resp. der Vater, Männer überhaupt. Was ist der Grund für diese Auslassung? Männliche Trauer untersteht ja in gewisser Weise bereits einer gesellschaftlichen Zensur.
Ja, das liegt natürlich an der heteropatriarchalen Struktur unserer Gesellschaft. Ausserdem stehen wir immer neben und hinter und vor vielen Tausend Jahren Theatergeschichte und Literaturgeschichte, die massgeblich weiblich gelesene Menschen ausschliesst. Das habe ich versucht umzudrehen, eine Leerstelle aus dem Heterosprechen zu machen. Wobei natürlich der Nummer Zwei Klassiker im Theater die Kategorie die trauernde Frau – Antigone etwa – oder eben die begehrte Frau ist, Klassiker Nummer Eins.
Manchmal schrecke ich davor zurück, Utopie zu schreiben: Wenn jetzt der Vater ein ganz präsenter Trauernder im Text geworden wäre, dann würde ich mich ärgern, weil ihm das ja eben so oft verwehrt wird – Bilder von Sorge tragen und Zärtlichkeitsbedürfnis und Auflösung. Ich finde, das ist ein Riesenfass, aber vielleicht schreibe ich ein Sequel!
Im zweiten, titelgebenden Text, Geister sind auch nur Menschen, sprechen vorwiegend alte Menschen, die auf dem Abstellgleis ‹Heim› gelandet sind. Alte Menschen sind Geister, so könnte eine Prämisse deines Texts lauten, weil sie längst vor ihrem körperlichen Tod einen sozialen Tod sterben. Du lässt sie in deinem Text hingegen aufleben und aufbegehren. Wäre das eine Form der literarischen Solidarisierung?
Ja, das wäre ein Versuch dazu, der hier zumindest in Textform mal stattfindet. Die Möglichkeit greifbar werden zu lassen, dass die Sprechenden sich ihre Selbstbestimmung gemeinsam erhalten wollen. Es ist ein kollektives Inerwägungziehen – und wenn sie davon schon etwas aufgegeben haben, sich diese zurückerkämpfen. Will heissen: progressive Aggressivität (im Rahmen der Möglichkeiten) darzustellen statt Bilder von passiven Investitionswidrigkeiten. Die vergangene Zeit, die Erfahrung, die vielen Wissen als Kapital – und für Institutionen gilt auch da irgend: «Souverän ist wer über den Ausnahmezustand entscheidet» (Carl Schmitt). Vielleicht hebeln sie diese Logik aus. Wer weiss. Ich fänd’s gut.
Indem du deinen Leser:innen auch noch der abstossendsten Figur gegenüber Mitleid abringst, verweigerst du ihnen, dass sie sich ein gutes Gefühl und damit ein gutes Gewissen abholen können. Inwiefern nimmt dieses gebrochene ‹Mitleid› eine zentrale Stellung in deiner Poetik ein?
Definitiv: Mitgefühl als subvertierende Kraft! Als Kraft zu nutzen, die uns so reich macht. Gott, das klingt moralisch, aber ja. Und das Urdemokratische daran ist: Sehen, erleben, vielleicht was noch nicht Erspürtes, Gewusstes über die Sache, die da zur Disposition gestellt wird – sinnliches Wissen sozusagen. Vielleicht wäre die Tragödie als das gemeinsame Erschürfen von sinnlichem Wissen, das wiederum in einen Diskurs überführt werden kann, zu verstehen. Hier haben wir es ja mit einem Buchtext zu tun, das heisst, ich bin in der Bearbeitung insoweit formal oder sprachlich vom Theatertext abgewichen, dass es flächiger wird, weniger Fragment im besten Fall. Und ich finde, es geht auch zentral um Trost! Wehrhaftigkeit im Sprechen ist quasi der erste Brocken vom Trost. Trost muss auch dynamisch und widerborstig sein dürfen.
Das Gespräch führte Shantala Hummler. / Foto: © Katja Brunner, Simon Krebs, Paula Fricke
Katja Brunner: Geister sind auch nur Menschen. 208 Seiten. Luzern: Der gesunde Menschenversand 2021, ca. 27 Franken.





