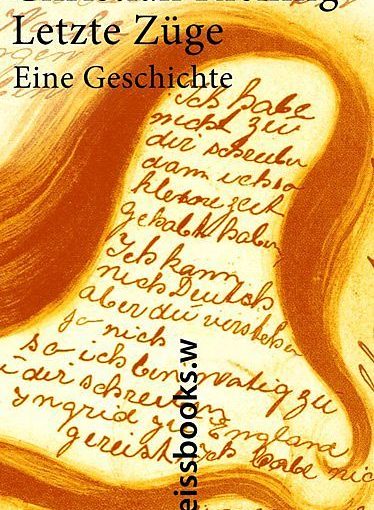Nachdem ich feierlich ein paar Hemdknöpfe mehr als gewohnt zugemacht habe, begebe ich mich ins Stadtheater, um Peter Stamm dabei zuzuschauen, wie er den diesjährigen Solothurner Literaturpreis entgegennimmt.
Bevor irgendwer auf der Bühne das Wort ergreift, leitet der Virtuose Jaap van Bemmelen die Preisverleihung mit seinem Gitarrenspiel ein. Sehr viele geschwinde Noten tupft er impressionistisch über langsame Grundrhythmen. Das klingt nach stiller Melancholie nach einem betriebsamen Tag. Da möchte man grad im weissen Anzug oder Kleid in der abendlichen Strandbar nachdenklich an einem Cocktail nippen, es ist aber erst halb elf.
Nach mehreren Tagen dynamischer Vorträge kommt einem Walter Pretellis darauffolgende Rede wohl steifer vor, als sie ist. Dabei erzählt er durchaus Anregendes über das Verhältnis von, ja, Buchhaltung und Literatur. In beiden Sphären werde eine Differenz von «Soll und Haben», von «Soll» und «Ist», sprich: von Fiktion und Realität gedacht. In solchen Differenz- und Grenzgebiete von Realität und Fiktion bewege sich auch der Schriftsteller Peter Stamm. Ja, doch, warum auch nicht; das hat was.
In seinem Ehrenwort verdankt Kurt Fluri ganz ordnungsgemäss Sponsoren, Gönnern, Gemeinden, Amtsträgern, lässt dann aber auch politische Noten antönen und verweist auf Debatten über Bibliothekstantiemen und Urheberrechte. Nachdem er ganz generell eine Lanze für die Kulturförderung gebrochen hat, verweist er auf die gute Sache, nämlich den Verein der Freunde der Zentralbibliothek Solothurn, der sich gewiss über Unterstützung für die zweitgrösste nichtuniversitäre Bibliothek der Schweiz freue:
Peter Stamm polarisiere ja durchaus, sagt Nicola Steiner in ihrer Laudatio, um Vorwürfen zuvorzukommen, die Jury habe es sich ja arg leicht gemacht mit so einem etablierten Autor. «An dem scheiden sich die Geister». Aber sein Werk steche konsequent heraus: Lakonisch und rhythmisiert erzähle es immer wieder vom Leiden an der Langeweile und vom Traum von anderen, nicht gelebten Leben; es verwische so gleichsam die Grenze zwischen Fiktion und Realität.
Von Fiktionen und Realitäten handelt auch eine «Facebookanekdote», die sie nacherzählt. Nachdem sie Peter Stamm in einem Beitrag markiert hatte, erhielt sie als Antwort: «Liebe Nicola, wie immer in solchen Fällen lösche ich diese Markierung und ergänze: Ich bin nicht dieser Peter Stamm. Die Welt ist klein und so teilen wir uns einige Bekannte, auch im richtigen Leben. Ich mag Ihre Arbeit ganz gerne, würde aber verstehen (mit Bedauern), wenn dieser Vorfall unsere FB-Freundschaft beenden würde. Liebe Grüsse, Peter Stamm». Das ist ein wenig rätselhaft, trifft aber in dieser gerade nicht beherzten Entzugsbewegung wie zufällig etwas für die Arbeit von Peter Stamm ganz Grundsätzliches.
Existenzielle Situationen, so Steiner weiter, würden bei Stamm ganz ohne Pathos, gleichsam mit Achselzucken aufgelöst. Kein Frage- und Antwortspiel dürfe man von ihm erwarten, sondern ein Frage- und Fragespiel. Als Autor male er nur genauso viele Pinselstriche, wie nötig damit man Schemen erkennen könne.
Dann kommt er endlich selber auf die Bühne, die Hände in den Hosentaschen, den Blick im 45 Gradwinkel vor sich auf den Boden gerichtet, lässt er sich gratulieren und verschwindet auch sobald er kann wieder von der Bühne, als sei er tatsächlich direkt aus einem der eigenen Romane nur zufällig hierher geraten. Nachdem Jaap van Bemmelen noch einmal ein paar, diesmal beschwingtere, Takte vorspielt, tritt Peter Stamm wieder auf die Bühne. Eine Dankesrede hat er statt einer Lesung vorbereitet. Auch eine solche liest er aber gewohnt ruhig. Das Gegenteil von Atemlosigkeit, könnte man sagen, obwohl Peter Stamm ja, wie ich gehört habe, gerne raucht.
Er rekapituliert Figuren aus seinen Büchern, die sich von der Literatur und vom Lesen abwenden. «Sogar Musik kam ihm nur noch vor wie eine Ablenkung vom Wesentlichen». Er zweifelt an der Macht und Unsterblichkeit der Literatur: «Schreiben ist Nebensache, Lesen ist Nebensache.»
So könnte er anfangen oder auch abschliessen, führt er aus: Wie wäre es, wenn er jetzt endigen würde mit seiner Rede. Wenn einige langsam den Saal verliessen, andere noch warteten: «Vielleicht kommt ja noch was». «Eine Geschichte ganz ohne Personen». Nach diesem konjunktivischen Exkurs stellt er aber klar: Er wollte sich immer der Wirklichkeit stellen, ihr nicht entfliehen. Literatur könne die Wirklichkeit nicht ersetzen. Ein Hilfsmittel, die Wirklichkeit klarer zu sehen, sei sie vielmehr. «Das sehen kann sie uns aber nicht abnehmen.»
Er träumt vom von einer Geschichte ganz ohne Personen und Verstummen und denkt an ein Leben, das noch gar nicht stattgefunden hat. Kein gravitätisches Schweigen schwebe ihm dabei vor, sondern ein heiteres; eines im Sinne von Wittgenstein: «Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen».
Dann entlässt uns ein weiteres Stück von Jaap van Bemmelen. Er endet mit einem offenen, fast fragend klingenden Akkord. Auch mit diesem könnte man, meine ich, grad so gut anfangen wie aufhören. Ganz am Schuss, als die Leute schon rausspazieren, kommt Peter Stamm noch mal auf die Bühne und lässt sich comme il faut mit Blumenstrauss und Jury fotografieren. Er sieht immer noch ein wenig unbehaglich, fast verzagt aus. Diesmal lächelt er aber.