KW27
Im Mahlstrom
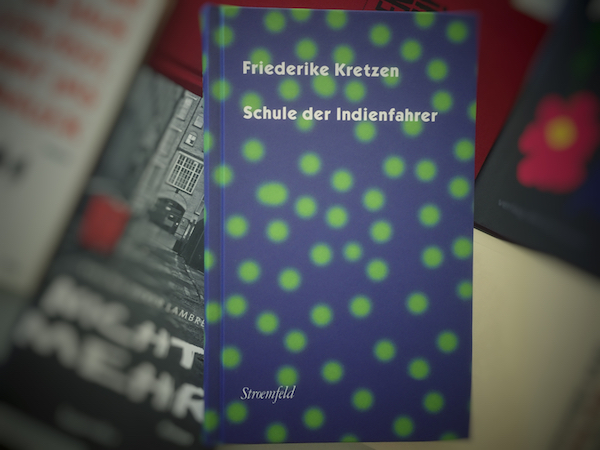
Friederike Kretzens jüngster Roman «Schule der Indienfahrer» ist psychedelischer Erinnerungstrip in die aufbruchsseligen Siebzigerjahre und melancholische Bilanz einer älter werdenden Träumerin. Poetisch stellenweise brillant, als Generationenporträt aber höchstens wider Willen geeignet.
Gedankenflucht
Helmudo hat angerufen, nach vierzig Jahren Funkstille. Einer von Alexanders Filmen werde in der Schweizer Botschaft in Delhi gezeigt. Die anderen seien schon informiert, hätten alle zugesagt. Klingt doch verlockend. Bis wir als Leser allerdings zu diesem Punkt in Friederike Kretzens neuem Roman kommen, sind bereits verwirrende vierzig Seiten durchwandert. Wir sind mit der Ich-Erzählerin Véronique im Bus über indische Landstrassen gefahren, haben sie bald als Mädchen im deutschen Nachkriegsmuff, bald als junge Giessener Studentin und Mitglied eines alternativen Laientheaters begleitet, in dem auch Helmudo und der Rest der Clique in den Siebzigern aktiv gewesen waren. Immer querfeldein durch die Tiefe der Zeit. Ein psychedelischer Erinnerungstrip in 27 «Lektionen».
Die Mehrzahl der Rezensionen zu Kretzens früheren Romanen – der jüngste verzichtet auf die Gattungsbezeichnung – sprechen jeweils wohlwollend von Traumtänzerei, von wirbelnden Erinnerungsfetzen, von Meditation. Einmütig verzeichnen Lesungsberichte das hypnotische Strömen und Rauschen der für die Autorin typischen Lyrismen, Assoziationskaskaden und Beschreibungsorgien, die, handlungsarm, nicht selten kohärenzschwach bis zur Unverständlichkeit, dennoch zu bezaubern vermögen. In den mittleren Lagen des Alltags hiesse eine solche permanente Rezeptionsüberforderung wohl Gedankenflucht. In den Höhenlagen des Kulturbetriebs firmiert dergleichen, wo es denn nur konsequent durchgeführt wird, natürlich als Stil. Und damit als Kunst. Die die Autorin auch in «Schule der Indienfahrer» tatsächlich konsequent weiterführt. So konsequent, dass es fast gleichgültig erscheint, welchen von Kretzens Romanen man liest. Sie alle bleiben doch immer das eine Buch als ein anderes.
Retrospektive Utopie
Ist die Gedankenflucht das narrative Movens von Friederike Kretzens Schreiben, so musste sich als Weg dahin zunächst eine ganz reale Flucht ereignen: raus aus Deutschland, raus aus der Muttersprache. Seit nunmehr über 30 Jahren lebt die 1956 in Leverkusen geborene Autorin, Dramaturgin und Literaturdozentin in Basel. Ein Akt der Entfernung, der Entfremdung von der eigenen Herkunft, welcher den imaginären Raum für Kretzens Schreiben damals zweifellos geweitet, vielleicht allererst eröffnet hat. «Ich bin hier, weil ich froh bin, dass ich nicht in Deutschland sein muss. Seit ich in der Schweiz bin, traue ich mich zu schreiben.» So war es, mit dialektisch gebrochener Kausallogik, vor Jahren in der taz zu lesen, zusammen mit einem Stück Poetologie: «Wie kann man einerseits die Gesetze der symbolischen Ordnung aufrechterhalten und andererseits etwas anderes machen?» Darin steckt zweifellos das postnatale Trauma der bundesdeutschen Nachkriegsgeneration, aber ebenso sehr deren intellektuelle Sozialisation durch Marxismus und Poststrukturalismus im «langen Sommer der Theorie» (Philipp Felsch). Die frühen Frauenromane der studierten Soziologin waren denn auch nicht zuletzt sprachlicher Guerillakampf gegen den Phallogozentrismus, besonders publikumswirksam im Pubertätsroman «Ich bin ein Hügel» (1998). Allgemeiner gefasst ist es die normative Zurichtung von Wirklichkeit und Identität, mit der Kretzen seit jeher schreibend ringt, an der sie ihren antiautoritären Stil entwickelt und verfeinert hat. Würde die Autorin aber tatsächlich über die symbolische Ordnung siegen, bedeutete dies zwar den endgültigen Triumph des Imaginären, aber eben auch den Abschied in den Wahnsinn. Es sei denn, das Andere realisierte sich als ein kollektives. Das ist die Utopie, die in Kretzens jüngstem Roman den Namen «Indien» trägt. Und keineswegs in der Zukunft angesiedelt ist, sondern vor aller Geschichte als unbewusstes Reservoir möglicher Vergangenheit liegt. Und darin liegt die grösste Stärke dieses Buches, das die euphorischen Halluzinationen der Siebzigerjahre weder verrät noch über Gebühr verklärt, sondern sie mit dem Mittel der melancholischen Retrospektive überblendet und, wenn auch nur zaghaft und fragend, Bilanz zieht. Darin eingerechnet sind die Verluste und Versehrungen. Die, die hängengeblieben, nie mehr wiedergekehrt sind, sich davongemacht haben ins Gebirge der Selbstverwirklichung. «Suchend begegneten wir dem, das grösser war als wir, anders, für das wir bereit waren, von uns abzusehen, uns ihm mit Haut und Haar zu verschreiben. Was uns ein wenig von unserer Traurigkeit erlöste, von der Wut, dem Gefühl von Nichtigkeit. Auch wenn diese Gefühle uns nie verlassen haben, unsere treuen Begleiter.»
Was ist geblieben?
Was an «Schule der Indienfahrer» nicht stilistisch, aber inhaltlich bisweilen befremdet, mag auch der Generationendifferenz geschuldet sein. So etwa der anklingende Opferstatus der Nachkriegsgeneration: Ist das nicht eine etwas selbstgerechte Traumabewirtschaftung im Fahrwasser von Baader Meinhof? Oder die im Ungefähren bleibende Situation Véroniques und ihrer Freunde heute: Würde eine welthaltigere Schilderung des Figurenpersonals und seines biografischen Werdegangs nicht deutlicher zum Ausdruck bringen, was an «Indien» als politischer Utopie auch heute noch lebensfähig ist? Oder anders gefragt: Sind diese schattenhaften, gleichwohl im Apparat (Film-Retrospektive in der Schweizer Botschaft…) ganz gut verankerten Existenzen wirklich alles, was von den Merve-Lektüren, Tunix-Kongressen, aktionistischen Improvisationen und nächtelangem Spintisieren übrigblieb? Eine sanfte Wehmut über die ungeahnte Widerständigkeit des Realen?
Am Ende jedenfalls hat es tatsächlich geklappt. Die grau gewordenen Freunde von damals sitzen gemeinsam im Garten der Schweizer Botschaft in Delhi. So selbstverständlich gehen sie miteinander um, als wären sie nie getrennt gewesen. Zu sehen gibt es Alexanders Film «Die Verschwundenen». Sie sehen sich selbst auf der Leinwand, ohne eine bewusste Erinnerung an die gezeigten Szenen zu besitzen. Ein Schlussemblem vielleicht, das Kretzens eigene Arbeit als unabschliessbares Projekt der poetischen Selbstfindung doppelt. Die gesellschaftliche Relevanz jedoch, der selbstkritische neben dem poetischen Blick in den Spiegel der Geschichte, die Dringlichkeit, sie sucht man in «Schule der Indienfahrer» so vergeblich wie auf neutralem Schweizer Boden. «Finden wir eine Sprache zu sagen, was mit uns geschieht?», fragt die Erzählerin einmal. Es wird eine rhetorische Frage gewesen sein.
Friederike Kretzen: Schule der Indienfahrer. 263 Seiten. Frankfurt a.M./Basel: Stroemfeld 2017. 35,90 CHF.





