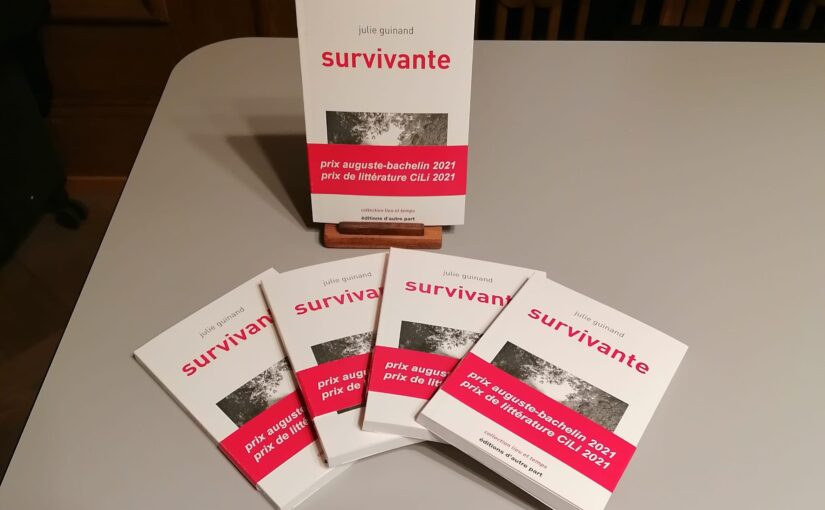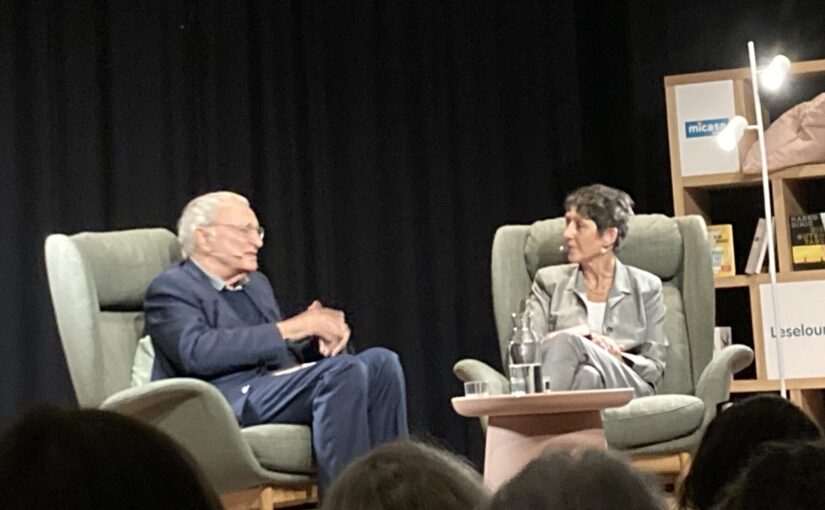Auf dem Podium stehen vier runde Tische, geschmückt für die Protagonisten des Abends, die heute im Rahmen des Schweizer Projekts «Weiterschreiben» hier sind. Die runde Form der Tische spielt auf die Form der Planeten im Weltall an. Hier auf dem Planeten Erde gibt es verschiedene Welten, die, anstatt friedlich miteinander zu kommunizieren, durch Lebensbedingungen, Politik und Kultur getrennt und unterschieden sind.
Dank dieses Projekts, das 2017 zum ersten Mal in Deutschland konzipiert und durchgeführt wurde, finden Autorinnen und Autoren aus Ländern, in denen ihre Worte zensiert und zum Schweigen gebracht wurden, den Raum, um ihre Arbeit, ihr Schreiben fortzusetzen und ihren Werken eine Stimme zu geben. In der Schweiz wird das Projekt seit 2021 durchgeführt und hat einen grossen Einfluss auf die zeitgenössische Literaturproduktion. Beispielhaft ist die Begegnung und die Geschichte von Azad Şîmmos Schreiben im Vergleich zum Schreiben von Gianna Olinda Cadonau. Aber mehr als ein echter Vergleich ist es ein Kontakt, eine kontinuierliche Kommunikation, wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise, von Gedanken und Visionen über das Leben in der Welt zwischen den Versen der Gedichte, die in Şîmmos Fall wegen der Sensibilität, die der Wortwahl gewidmet ist, und der starken Emotionalität, die den Tönen innewohnt, mitten ins Herz treffen; Verse, die von Gianna, die existenzielle Fragen nach sich ziehen und die jeden von uns Menschen in Frage stellen und uns ein wenig verunsichert zurücklassen. Şîmmo liest Gedichte aus den Sammlungen Belki Sensin Özlediğim (2015) und Avaşîn (2022) in der türkischen Originalfassung; Cadonau liest Gedichte aus den rätoromanisch/Sammlungen Ultim’ura da la not / Letzte Stunde der Nacht (2016), pajais in uondas / wiegendes Land (2020) und aus seinem Roman Feuerlilie (2023).
In der Einführungsrede zur Lesung und Diskussion der Texte wird einer der schönsten Sätze Ludwig Wittgensteins zitiert: «Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt» – der perfekte Satz, welcher sofort das problematische Bild des Verbots und das Fehlen des Rechts auf freie Meinungsäusserung wiedergibt. An diesem Abend trafen die Worte von Şîmmo, der nach einer schmerzhaften Vergangenheit in der Türkei in der Schweiz willkommen geheissen wurde, auf die Worte von Cadonau. Die beiden arbeiten an einem Tandem, auf dem ihre Zusammenarbeit beruht. Die Persönlichkeit von Şîmmo spiegelt sich in den Versen seiner Gedichte wider und wird in seinen Worten voller gemischter Gefühle erneut bestätigt. Das Glück und die Freude, im Projekt Weiter Schreiben Schweiz eine neue Familie gefunden zu haben, werden von Şîmmo immer wieder wortwörtlich hervorgehoben, der zugibt, in der Schweiz eine Möglichkeit gefunden zu haben, ohne Grenzen an seinem Schreiben zu arbeiten. Nicht einmal die Vielfalt der Sprachen, die bei den Kreativitäts- und Schreibtreffen aufeinandertreffen. Der Austausch zwischen Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Nationen und Kulturen führt zu einem Werk, das nichts weniger ist als die richtige Mischung aus Sichtweisen und Charakteren, die in Prosatexten und Versen umgesetzt werden.
Für Cadonau bedeutet die Arbeit mit Weiter Schreiben Schweiz, dass wir über das nachdenken, was tief in uns steckt, und es nutzbar machen. Schreiben heisst also, sich zu fragen, was man aus dem, was man in sich trägt, mit seinem Innenleben machen kann. Für sie ist WSS ein «konkreter und kostbarer Ort», an dem Worte Gewicht haben und dieses Gewicht eine Spur hinterlässt. Was bleibt, ist sicherlich der Moment der Reflexion, der die Anwesenden am Ende eines jeden Textes beschäftigt. In seinen Gedichten ist Şîmmo er selbst, frei und voller weiblicher Figuren, voller Nostalgie, voller Traurigkeit über diejenigen, die nicht die gleichen Schritte wie er machen konnten, weil sie zurückgeblieben sind. Die Aufgabe seiner Poesie ist es, sich an diejenigen zu erinnern, die in seiner Heimat geblieben sind, und auf die Distanz zu reagieren, die die schweizerische Realität ausfüllt, indem sie ihm eine «Literatur-Mutter» schenkt, womit er von seiner ersten Leitfigur in Weiter Schreiben Schweiz spricht.
Erst später lernt Şîmmo Cadonau in der Projektgruppe kennen, und die Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelt hat, geht weit über das hinaus, was man vermuten würde. Die beiden unterscheiden sich in ihren Schreibmethoden. Einerseits gelingt es Simmo, seine Gedanken in seinen langen Gedichten zu entladen, oft in anaphorischen Wendungen, die auch dem ins Deutsche übersetzten Text Musikalität verleihen. Das gleichzeitige Werk aus Lyrik und Roman umfasst auch Übersetzungen seiner türkischen Gedichtbände, die derzeit in Bearbeitung sind. An diesem Abend war es möglich, mehrere türkische Gedichte in deutscher Übersetzung zu hören, bevor sie offiziell veröffentlicht werden. Der Überraschungseffekt im Publikum war an den leuchtenden Augen und ernsten Gesichtern abzulesen. Ja, denn Şîmmo Gedichte lassen Szenen von Gewalt und Ungerechtigkeit lebendig werden, ohne sie wirklich zu beschreiben, sondern lediglich die Gefühle und Reflexionen zu beschreiben, die sie in den von ihm ausgewählten Personen hervorrufen.
Wenn Cadonau über die Reflexion nachdenkt, die den Ausgangspunkt seiner Arbeit bei Weiter Schrieben Schweiz bildet, spricht sie von einem «sich erfinden»: ein Fremder im Land des Wachstums zu sein, wie im Land der Herkunft und das Schreiben ist eine weitere Art, sich fremd zu fühlen, weil es bedeutet, zu arbeiten, zu entwerfen, ohne zu wissen, wo man ankommt und wo man für längere oder kürzere Zeit bleiben wird.
Materialismus, widerständiger Feminismus und historischer Evolutionismus stehen im Mittelpunkt von Şîmmos Poetik, in der der Übergang zwischen Gegenwart und Vergangenheit von Angst und Schmerz geprägt ist. Şîmmo dankt seinem Mitarbeiter Cadonau mehrfach. Diese wiederum bedankt sich bei Simmo: Man braucht zwar Zeit, um sie sich zu verstehen, um vor allem die Texte von Şîmmo und ihre Botschaft zu verstehen und auch wenn die Kommunikation langsam erscheint, bei ihrer Arbeit sieht Cadonau keine gesetzten Grenzen. Ein weiterer Beweis dafür, dass Literatur sowohl über sprachliche als auch über politisch-gesellschaftliche Grenzen hinausgeht.
Die Lesung endet mit einigen Vorschauen auf die Produktion von Cadonau und Şîmmo. Gianna Olinda Cadonau wartet auf den nächsten Sommer, um sich dem Schreiben neuer Gedichte zu widmen, während Azad Şîmmo derzeit an ihrem neuen Roman arbeitet. Das Publikum, bestehend aus Leuten unterschiedlichen Alters und einer grösseren Anzahl junger Leute, applaudiert lange als Zeichen des Dankes für das Wunderbare der Gegenwartsliteratur.