Wenn Tom Gabriel Fischer, Mitbegründer der einst global erfolgreichen Metal-Band «Celtic Frost», und Philipp Theisohn, Germanistikprofessor an der Universität Zürich, zum Gespräch laden, findet sich im Lesungssaal nicht unbedingt das bekannte Literaturhauspublikum ein. Und auch der Ton auf der Bühne entspricht nicht dem allzu Erwartbaren.
«Tja, was machen wir?», eröffnet Theisohn den Abend und stellt sogleich zu Beginn klar, dass hier kein verkopftes literarisches Quartett zu erwarten ist. Quartett schon gar nicht, denn aus dem Trio ist leider ein Duo geworden, der Dritte im Bunde, Schriftsteller und Journalist Dietmar Dath konnte leider coronahalber nicht einreisen. The virus is a satan, an dieser Stelle.
Was machen sie also? In guter alter Oberseminar-Manier versucht Theisohn zunächst, einen gemeinsamen Horizont herzustellen und das Wesen des Heavy Metal zu befragen. Dazu Fischer, der durchaus Parallelen zum Punk sieht: «Es geht um die Sicht auf die Welt, eine Perspektive, die der Text einem gibt.» In diesem Kontext verweist Theisohn auf Fischers Buch mit dem eher weniger zweideutigen Titel «Only Death Is Real», das er für den Agglo-Diskurs der 1980er als kulturarchäologisch wesentlich erachtet. Fischer bestätigt diese Einschätzung und plaudert aus dem pubertären Nähkästchen auf dem Land und betont, dass es darum vor allem darum ging, aus ehrlichen Motiven zu handeln. Und immer darauf zu achten, dass aus der Gegenbewegung von gestern nicht der Mainstream von morgen werde.
Diese Kritik am Mainstream – auffällig auch in der Punkszene –, und das Gerede davon, nicht Sklave des Konsums und des Markts sein zu wollen, steht allerdings heute selbst in auffälliger Nähe zum Mainstream. Anhand eines äusserst amüsanten «Manowar»-Videos gibt Theisohn deshalb zu bedenken, dass jede behauptete Authentizität immer auch als Inszenierung verstanden werden könne und durchaus auch müsse. Das erste Mal fällt die These, dass auch Metal letztlich Bedürfnisse erfüllt, beispielsweise im Zelebrieren eines Heldenkults. Mit Held*innen kennt sich die Germanistik indessen aus, und so wagt sich Theisohn schliesslich an die ganz grosse Auslegung: «Wo steht hier das Ich?»
So viel Universität war im Entstehungsprozess aber offenbar nicht intendiert: «Wir waren damals Bubis», sagt Fischer und wünscht sich offenkundig ein anderes Thema. Hätte Dath hier geholfen?
Theisohn lässt aber nicht locker und versucht, über den Begriff des Tyrannen einen neuen Zugang zu bauen, verweist auf dessen Ambivalenz. Doch Fischer zieht es eher zu seinen Erinnerungserzählungen aus der Szene.
Metal ist nicht für den Schongang bekannt, und so versucht Theisohn nochmals mit dem Thema Drastik einen gemeinsam Zugang zu finden. Was also bedeutet Metal, der dermassen extrem und auf den ersten Blick destruktiv ist? Metal, der beim Schrecken bleibt und vom Schockmoment in ein Verharren übergeht? Als ein krasser Text von Slayer aufgelegt wird, gerät die Diskussion endgültig ins Stocken. Theisohn möchte sich in diesem grössten Horror auf poetologische Spurensuche begeben, doch Fischer tilgt jeden Analyseversuch: «Das ist alles schön und gut, aber wir haben eine Verantwortung und müssen uns der Wirkung eines Textes bewusst sein.»
Schade, dass Theisohn und Fischer auf dieser Ebene nicht zueinander fanden. Gerade die Frage, welchen Anteil kulturelle Artefakte an tatsächlichen Straftaten haben können, wäre einer vertieften Betrachtung würdig gewesen.
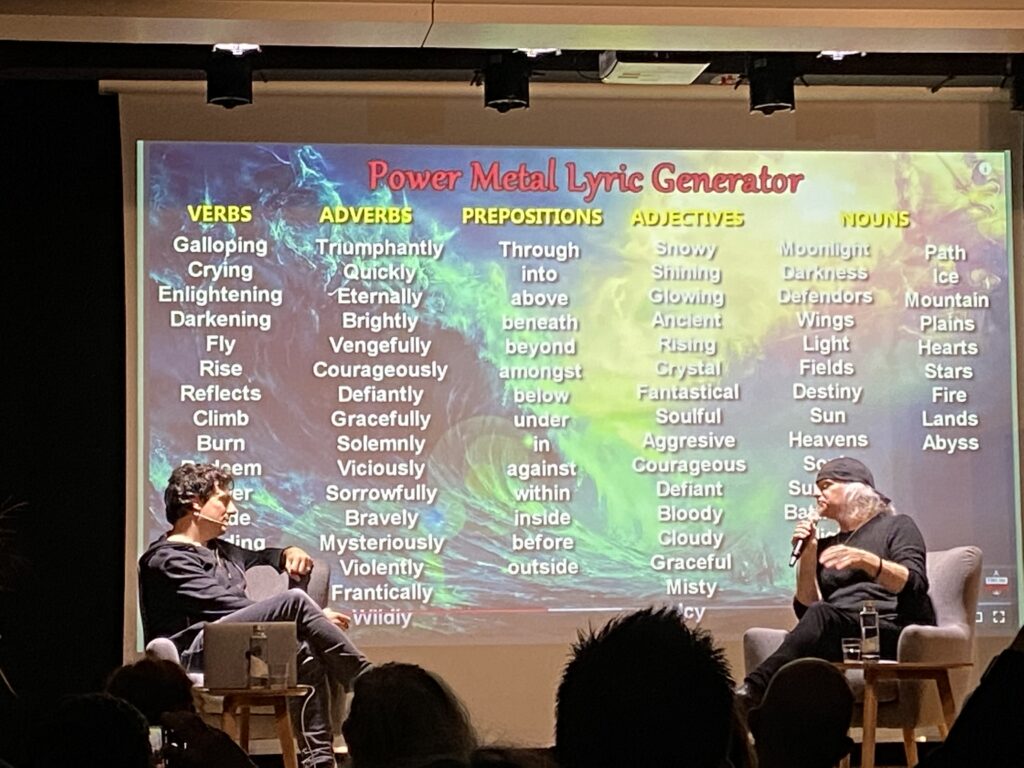
Text und Bild: Katharina Alder/Redaktion: Christoph Steier

