KW46
Ein Rohrschachtest für die Macht des Erzählens
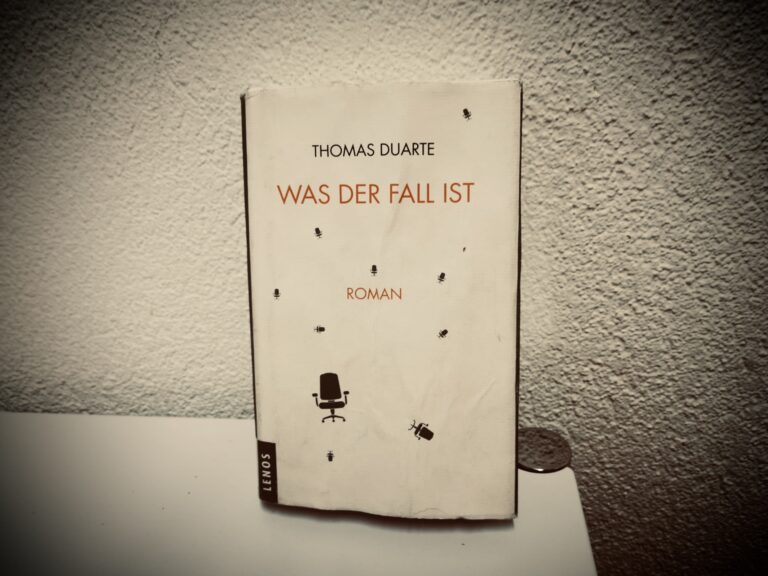
Schon vor Veröffentlichung mit dem Studer/Ganz-Preis für das beste unveröffentlichte Debüt bedacht, suggeriert Thomas Duartes «Was der Fall ist» auf der Oberfläche Schlichtheit. Beim Lesen jedoch zeigt sich, wie unter der Hand langsam, aber stetig am Absurditätsregler gedreht wird und wir uns bald im lustvollen Hanebüchenen wiederfinden.
Der namenlose Erzähler betritt eines Nachts durchnässt und zerkratzt einen Polizeiposten und beginnt dort zu erzählen, wie er als Büroangestellter eines Hilfswerks an der Jahresversammlung mit Betrugsvorwürfen konfrontiert worden ist; wie er eine Affäre mit der Reinigungsarbeiterin Mira angefangen hat; und wie er diese und einen Freund von ihr bei sich aufgenommen hat. Warum er dem Nachtschichtpolizisten all das erzählt, weiss er vielleicht selbst nicht ganz, aber er redet – mal charmant, mal philosophisch, angeberisch, mal in Schutzbehauptungen. Er entlarvt sich dabei, etwa als kleinlich, grosssprecherisch und gelegentlich latent sexistisch. Derweil gewinnt ein eigentümlich doppeldeutiger Protagonist immer mehr an Kontur: gesellig-ungesellig, thesenverliebt und doch zaudernd, fast ganz allein auf sich selbst zurückgezogen und doch fasziniert von der Idee der Weltläufigkeit.
Später schreibt er einen Bericht über diese gesprächige Nacht und liest diesen dann seinem Chef Franz vor, was dem Autor Duarte Gelegenheit für launige Geschichtenverschachtelung und Ebenensprünge gibt, während sein Protagonist zu ergründen versucht, warum er Mira, die ohne Aufenthaltsbewilligung war, mit seinem Erzählschwall bei der Polizei ans Messer geliefert hat.
Irgendwann beginnt man zu ahnen, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht, dass hier mehr Lug und Trug und doppelter Boden am Werk sind, als man zunächst vermuten konnte. So scheint das Hilfswerk, das vom mysteriösen Superreichen Franz ins Leben gerufen wurde, keine klar bestimmten Kriterien dafür zu haben, welche Geldgesuche es bewilligt, sondern scheint Franz eher dazu zu dienen, seine exzentrischen philosophischen Ideen umzusetzen – und die Gesuche, die der Protagonist da bearbeitet, klingen allesamt wie Räuberpistolen…
Duartes Prosa ist dabei glatt und von einer angenehm bescheidenen Eleganz. Auch dort, wo sie von einem Redeschwall erzählt, verbietet sie sich den sprachlichen Übermut und alle Effekthascherei:
«Ob die Leute etwas anfangen mit dem Geld oder nicht, ob sie es irgendwo hineinstecken, ob sie Pläne damit haben oder nicht, das ist uns vollkommen egal, darum geht es gar nicht. Wir machen keine Investitionen, hegen keine Absichten, schielen nicht auf Erfolg. Vielleicht hat Makwenge das nur ein bisschen besser begriffen als die anderen. In Wirklichkeit, sagte ich zu Ramón, bezahlen wir die Leute dafür, dass sie uns ihre Geschichten erzählen.»
Der Roman funktioniert vorzüglich als Psychogramm eines Protagonisten und seiner Ambivalenz gegenüber dem, was man vielleicht Erlebnis- oder Erfahrungsgehalt nennen könnte; ein Hin und Her von Angst und Begierde. Das ist zwar deutlich auf die moderne Bürowelt dieser Figur bezogen, aber zu weit ins Exzentrische hochgeschraubt, um auf das soziale Allgemeine wirklich zielen zu können. Wo der Roman als Gesellschaftssatire im engeren Sinn wirken könnte, kommt ihm die eigene fintenreiche Erzählfreude in den Weg; zu weit wagt er sich mit kühnen Einfällen ins Wilde hinaus, als dass noch an Spitzen gegen den zeitgenössischen Arbeitsalltag zu denken wäre. Karikatur und Kritik geraten gewissermassen in Konflikt.
Näher am Puls aktueller Fragen bewegt sich das Buch, wenn es indexiert, wie sehr seine Protagonist:innen von gesellschaftlichen Rollen, Situationen, assoziativen Erinnerungen, kaum greifbaren Gefühls- und Stimmungslagen bestimmt sind, und wie viel vom Reden Rationalisierung und Rechtfertigung ist. Gerade in diesem letzten Punkt ist Was der Fall ist aber auch ein ausgezeichneter, selbstreflektierter Rohrschachtest für den Glauben an die Macht oder Ohnmacht des Geschichtenerzählens: Ob man den Roman als Inszenierung eines Triumphs oder einer Niederlage nimmt, eines Siegs der Selbst- und Sinnstiftung durch das Erzählen oder eines per se vergeblichen Versuchs, das ewig, alles durchatmende Nichts mit Geschichten zuzuschaufeln, wird vor allem davon abhängen, wie man über solche Sachen im Allgemeinen denkt.
Thomas Duarte: Was der Fall ist. 301 Seiten. Basel: Lenos Verlag 2021, ca. 32 Franken.




