KW45
Von einer, die unterging
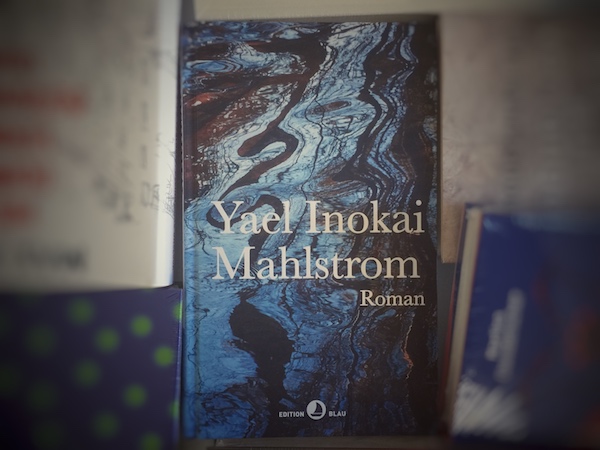
Ein Text aus Wasser: Yael Inokais «Mahlstrom» lässt eine Figur im Strudel des Erzählens ertrinken. Am Ende steht ein grosser Roman über die subtile Gewalt der Dörfer.
Jede Geschichte muss zu ihrem eigenen Ende finden, manche jedoch werden vom Schlusspunkt her geschrieben. Wer zurückbleibt, wenn jemand der Geschichte seines Lebens ein Ende setzt, fühlt sich retrospektiv zur Suche nach einer kohärenten Erklärung gedrängt, die immer auch Erfindung sein muss. Wie so ein Mensch zu reden geben kann, der für immer schweigt, verhandelt Yael Inokai in ihrem zweiten Roman «Mahlstrom».
Eine 22jährige Frau wird im Wasser gefunden, die Manteltaschen mit Steinen beschwert. Von den Ereignissen, die folgen, und von vergangenen, die sie verbanden und letztlich auseinanderbrachten, erzählen drei junge Menschen, die in derselben Dorfgemeinschaft aufgewachsen sind. Abwechselnd, teilweise in perspektivischen Überblendungen, skizzieren sie die Kindheit in einem rauen Tal, die elementaren Rituale des Dazugehörens und Ausgeschlossenseins. Anstand nennt man in dieser Gemeinde, was vorgibt, wie Begegnungen zu gestalten oder eben zu verhindern sind, und worüber man schweigt. Auch der Todesfall unterliegt solchen Vorgaben: Ein Dorf trauere eigentlich lückenlos, heisst es im Buch.
Verbunden ist die Erzählgemeinschaft freilich nicht nur durch den Suizid Barbaras (so heisst die Tote). An ihrem Beginn steht eine aus kindlicher Ablehnung resultierende Gewalttat. Erzählt werden das traumatische Ereignis wie der sich ihm anschliessende Vorgang des Totschweigens von Yann – dem Opfer –; welche Rolle der Ertrunkenen hierbei zukam, von ihrem Bruder, einem der Täter. Lange leugnet dieser den Hergang, verweigert sich den Schrecken seiner Biographie, bis das Eingeständnis des eigenen Scheiterns auch zum öffentlichen Bekenntnis wird. Subtil vermengt Inokai hier die Phänomene Gewalt und Homosexualität und illustriert das Verhältnis von Norm und Abweichung als eines, das Identitäten heranbildet und zerstört. Durch Schilderung, nicht durch Anklage entblösst sie die Dorfgemeinschaft als ein Kollektiv, in dem abweichende Lebensentwürfe nicht willkommen sind. Als dritte im Ensemble spricht Nora, die poetisch-reflektierte, distanzierte und auch sich selbst gegenüber schonungslose Beobachterin. Halb Täterin, halb Zeugin des Geschehens, und quasiliterarische Instanz des Romans, erhält sie das umfangreichste Textkontingent.
Durch die Mehrstimmigkeit der Erzählung erfahren wir die Persönlichkeit der Ertrunkenen als eine prismatisch gebrochene: Barbara fächert sich in mehrere Figuren auf. Sie, von der gesagt wird, ihr unmöglicher Körper sei immer im ganzen Raum gleichzeitig gewesen, bleibt posthum eine Leerstelle. Lebendig wird sie nicht mehr: weder im physischen noch im narratologischen Sinne, nicht durch die erzählerische Anstrengung ehemaliger Gefährten, noch durch die Schilderungskraft Inokais.
Beinahe durchgängig gilt: Was am Roman zu bemängeln wäre, kann man ihm auch zugute halten. Die Komposition sowohl der Figuren wie der Dramaturgie gelingt konsequent. Die szenischen Skizzen gewinnen gerade in der Andeutung und in dem ruhigen, schwebenden Ton poetische Kraft. Das schwächt unweigerlich die Figürlichkeit der einzelnen Erzähler, deren Identität primär biographisch begründet wird und sich aus dem sozialen Klima zu ergeben scheint. Ihre Stimmen unterscheiden sich hingegen nicht deutlich genug voneinander, um sich von der Poetik des Liquiden, von der Mahlstrom vom Titel bis in abseitige Details abhängt, ernstlich zu emanzipieren.
In Barbaras Abschiedsbrief, lässt uns ihr Bruder in einem der letzten Kapitel wissen, findet sich der Satz: «Ich denke, es wäre mehr möglich gewesen.» Auch wenn er selber sich ob der Uneindeutigkeit ärgert, die derart für immer stehenbleiben muss: Dem Leser unterstreicht noch einmal, dass es sich für alle Beteiligten um eine Erzählung der ungeschriebenen Geschichten handelt. So baut die sachte Zuversicht, die am Ende aufscheint, auf der Erkenntnis auf: Wer sich als menschliches Treibgut versteht, muss verdrängen.
Yael Inokai: Mahlstrom. 180 Seiten. Zürich: Rotpunkt 2017. 26 CHF.





