Ein nebliger Sonntagmorgen, die Sinne schlaftrunken – zusammen mit Michelle und Seraphin betrete ich die «Blinde Kuh». Mäntel und Taschen werden eingeschlossen, Notizbuch und Handy abgenommen: festhalten, schreiben und fotografieren, das geht hier nicht – wir werden zu «richtigen» Zuhörerinnen. Obgleich die Dunkelheit der Nacht noch nicht weit zurückliegt, brauchen die Augen Zeit, um sich an das Schwarz zu gewöhnen. Um die süsse Erinnerung an den Schlaf zu bannen, bestelle ich mir einen Kaffee. Irgendwann erlangen die Hände eine Ahnung für den Raum.

Das Restaurant füllt sich, lebhafte Gespräche und das Klirren und Klappern der Teller und Gläser erinnern an eine normale Beiz. Die Dunkelheit ist nun nicht mehr beengende Abwesenheit, sondern schärft die Sinne für anderes, auch für Michael Fehrs Stimme, die alsbald den Raum einnehmen wird. Die Süppchen sind leer und die Häppchen weg, als der Lyriker uns mitteilt, dass seine erste Geschichte von Essen handle. Er erzählt von der Königin im Wald, von einer Schlange, die einen alten Mann verspeisen möchte, um ihre stattliche Postur zu bewahren. Sie prahlt ausufernd mit ihrer Schönheit, Grösse und Stärke, die so weit reiche, dass ein Stein von ihrem Biss zu bluten beginne. Der alte Mann verliert ob dieser Selbstinszenierung die Furcht und wagt es, sich von der Schlange zu entfernen. Das Publikum bleibt ratlos zurück, und Michael Fehr verkündet: «So ist die Geschichte fertig».
Er wolle bewusst offen lassen, ob die Schlange lüge oder die Geschichte ein Märchen sei, in der Steine zerbissen werden können. Darin liege gerade das Potential einer Erzählung: die Zuhörer in einem Schwebezustand zu belassen, der Vieldeutigkeit, nicht aber Beliebigkeit bedeute. Denn beliebig ist keine der Geschichten, die uns Michael Fehr an diesem Morgen erzählt. Ihre Sinnkonstruktionen entstehen zwar nicht durch das Abrufen bekannter Muster, aber durch Farben, Bilder, Klänge und Rhythmen.
Um das Publikum zu schonen, habe er mit einer «leichten» Geschichte begonnen, denn andere Texte erzählten expliziter von Gewalt. Ironisierende Distanz zu schaffen, wie er es sich sonst gewöhnt sei – durch Mimik und Gestik seiner zierlichen Statur – gelinge heute nicht. Im Dunkeln sind wir den Worten viel direkter, beinahe schonungslos ausgeliefert.
Doch die «Blindheit» öffnet vielleicht auch einen neuen Zugang zum Raum der Fantasie, für den der Lyriker an diesem Morgen plädiert. Das «westliche Schreiben» sei geprägt vom Psychologisieren und knüpfe an seine Tradition an. Aber vielleicht liege gerade im Mut, sich Neues auszudenken und zu schaffen und dabei das Anknüpfende, Erklärende in den Hintergrund zu rücken, eine wirkliche Kraft. «Ich war schon alt, als ich zu schreiben begann. Ich hatte keinen klaren Platz», sagt Michael Fehr. Durch das Erzählen, vielleicht auch sich selbst erzählen, kann man sich einen Platz schaffen, in Momenten wo man ihn nicht noch zu kennen meint. So brauche es oftmals nur einen kleinen Schritt, um sich zu lösen. Doch liege es in der Natur des Menschen, dass man diesen oft nicht gehen könne – wie der Protagonist in der Erzählung Im Schwarm, der in einer Sommernacht von Mücken zerstochen wird und es nicht schafft, sich aus dem Licht zu begeben.
Als ich die «Blinde Kuh» verlasse, fordert die grelle Sonne eine zweite Gewöhnung, doch die aus Dunkelheit geschaffenen Bilder vertreibt sie nicht. Und mir wird bewusst, dass es weder Stift noch Kamera braucht, um einen Zugang zu gewinnen. In erinnere mich an einen Satz von Kafka: «Die Vorbedingung des Bildes ist das Sehen», sagte Janouch, und Kafka erwiderte: «Man photographiert Dinge, um sie aus dem Sinn zu verscheuchen. Meine Geschichten sind eine Art von Augenschliessen.»

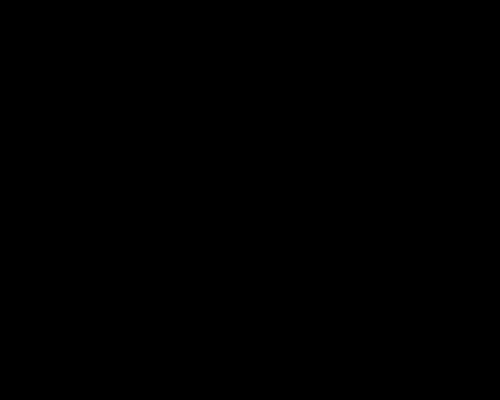


 Vordergründig gibt sich das Buch als Agentenroman aus. Tatsächlich dreht es sich aber um alle möglichen Versionen der Täuschung und geht der Frage nach, wie Vertrauen zerstört wird. Natürlich folgt die Verdichtung der Lebensläufe den Regeln der Fiktion, aber «alle Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind mehr oder weniger so passiert», versichert Kraus.
Vordergründig gibt sich das Buch als Agentenroman aus. Tatsächlich dreht es sich aber um alle möglichen Versionen der Täuschung und geht der Frage nach, wie Vertrauen zerstört wird. Natürlich folgt die Verdichtung der Lebensläufe den Regeln der Fiktion, aber «alle Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind mehr oder weniger so passiert», versichert Kraus.










 Die Zeit der Lesung war längst überschritten, aber das Publikum hing noch immer wie gebannt an ihren Lippen. Buguls Geschichte fasziniert. Obdachlosigkeit ist mit Vorurteilen behaftet, verkörpert Gefahr und gesellschaftlichen Fall. Diese starke Frau hat sich ihren Ängsten gestellt und sich so von ihnen befreit. Sie galt als Verrückte und lebte verstossen von der Gesellschaft. Wir, die durch unser behütetes Schweizer Leben ängstlich geworden sind, können von ihrer Narrenfreiheit nur lernen.
Die Zeit der Lesung war längst überschritten, aber das Publikum hing noch immer wie gebannt an ihren Lippen. Buguls Geschichte fasziniert. Obdachlosigkeit ist mit Vorurteilen behaftet, verkörpert Gefahr und gesellschaftlichen Fall. Diese starke Frau hat sich ihren Ängsten gestellt und sich so von ihnen befreit. Sie galt als Verrückte und lebte verstossen von der Gesellschaft. Wir, die durch unser behütetes Schweizer Leben ängstlich geworden sind, können von ihrer Narrenfreiheit nur lernen.