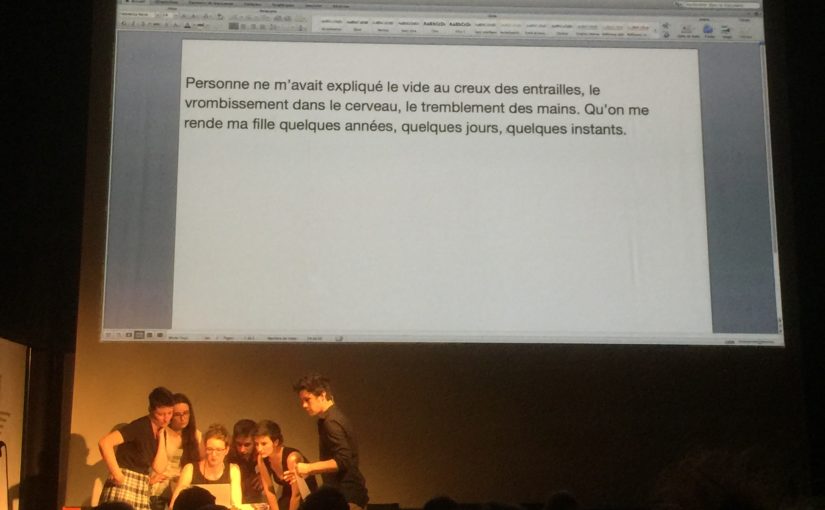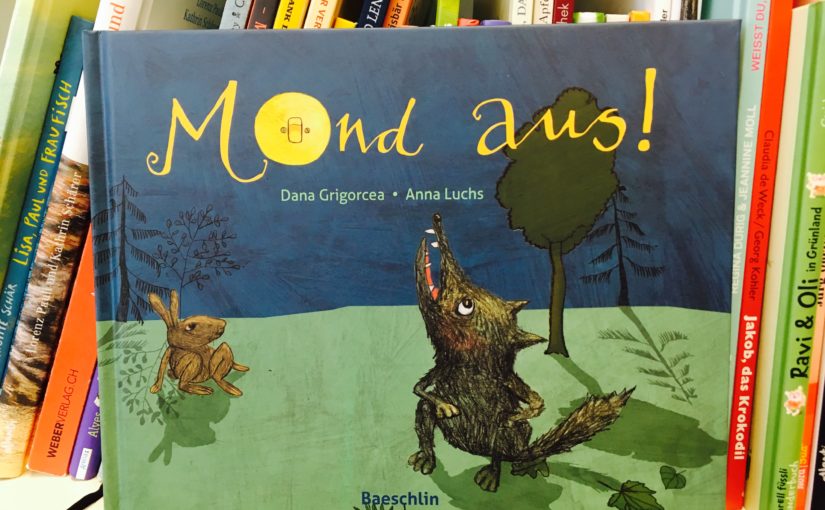«Schön, dass doch noch ein paar gekommen sind», sagt der Moderator Stefan Humbel ironisch zu dem gefüllten Landhaussaal, vor dem sich bereits eine halbe Stunde vor Lukas Bärfuss‘ Lesung eine Schlange gebildet hat. Den gefeierten Autor einmal aus seinem neusten Roman «Hagard» lesen zu hören ist ein Erlebnis, bei dem die manchmal auch sperrige Geschichte neu zu erfahren ist. Bärfuss blüht im gehässigen inneren Monolog des Protagonisten Philip förmlich auf, wenn dieser wie ein Gejagter im öffentlichen Verkehr vor den gelben Westen der Kontrolleure flieht und die halbe Welt beschimpft. Ohne eine Miene zu verziehen und mit einer Sprachmelodie, die erst beim Vorlesen zum Vorschein kommt, bringt Bärfuss mit seinem Text den ganzen Saal zum Lachen.
In Bezug auf den Romantitel «Hagard» – was in der Falknerei für einen unzähmbaren Wildfang steht –, beschreibt Bärfuss sich selbst im kurzen Gespräch mit Humbel eher als Vogel denn als Ornitologen. Beim Schreiben sei er wie ein Jäger, der ausharren und auf seine Beute warten muss. Dabei beschäftigt Bärfuss die Frage, woher sich ein Autor das Recht nimmt, mit seinen Figuren so umzugehen? Vor allem Frauen in bürgerlicher Literatur fallen ihren Autoren zu Opfer wie etwa Madame Bovary, die grauenvoll am Boden verenden muss. Bärfuss fragt sich, was es dem Publikum gibt, diese Figuren so leiden zu sehen? Entweder sei es die Empathie oder eben einfach Schadenfreude. Er vergleicht das mit dem unverschämten Gefühl der Leichtigkeit, wenn man von einer Beerdigung nach Hause gehe und froh ist, dass es einen selbst noch nicht erwischt habe. Diese Überlegungen zeigen sich im Roman in der Fokussierung auf die Erzählfigur, welche ihr Verhältnis zur Geschichte von Philip immer wieder reflektiert.