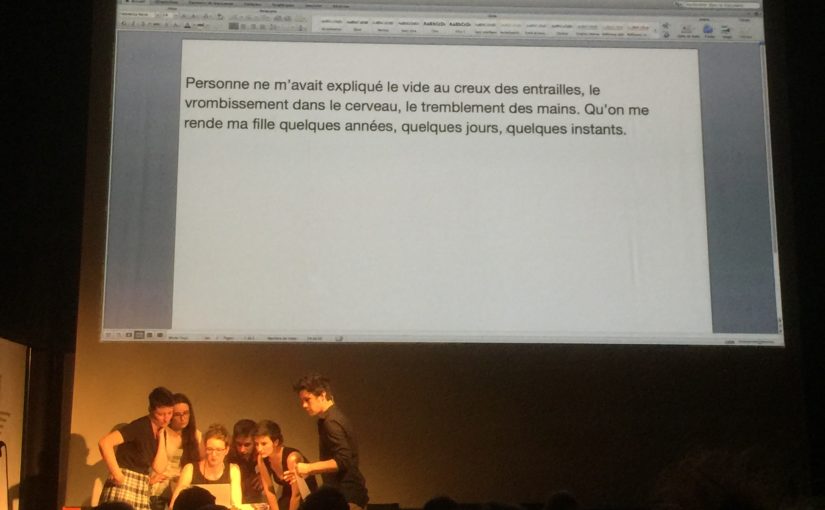Ein wenig nervös erscheint Flurin Jecker zur Lesung seines Debütromans „Lanz“ in der Säulenhalle. Er: 26-jährig; das Publikum mehrheitlich doppelt so alt; der Roman ein Buch über einen pubertierenden Jungen. Ob diese Kombination funktionieren kann? Sie kann! Lanz‘ Jugendsprache, in der die Fliegen und Kühe herumlatschen und alles ULTRA dramatisch und ULTRA schlecht ist, zieht einem sofort in die Untiefen eines Teenager-Universums. Das Publikum lacht und denkt dabei wohl auch an die eigene verkorkste Jugendzeit zurück. Auch Flurin Jecker erlaubt sich bei einigen Passagen zu lachen, nun wissend, dass er das Publikum in der Tasche hat. Einziger Kritikpunkt, wenn man Lanz hört, ist, dass seine Gedankensprünge von Erzählungen über die Kindheit wieder zurück zur Realität nicht immer ganz klar sind. Ob es daran liegt, dass er in Blogform schreibt, und ein Blog eben zum Selberlesen gedacht ist?
Moderatorin Karin Schneuwly möchte denn auch von Jecker wissen, was ihn denn so an diesem Teenie-Alter fasziniert habe, dass er gleich seine Abschlussarbeit des Schweizerischen Literatur-Instituts in Biel darüber geschrieben habe. Jecker meint, er habe einfach begonnen zu schreiben. Irgendwann habe er dann gemerkt, dass seine Hauptfigur ziemlich viel zu sagen hätte, und dass diese eben noch sehr jung sei.
In diesem Alter verlässt man seine Kindheit, man verliert die Geborgenheit und enge Verbindung zu den Eltern, aber hat nichts womit man diese Lücke füllen kann. Man geht ja immer noch zur Schule; aber man lebt wie in einem Spalt – das Alte ist vorbei, das Neue aber noch nicht da.
In der anschliessenden Signierstunde zeigt sich, dass Flurin Jecker ein sympathischer junger Autor ist, der noch immer von seinem eigenen Erfolg überrascht und überwältigt ist und sich deshalb über jeden einzelnen freut, der seinen „Lanz“ mit einer persönlichen Widmung nach Hause tragen möchte.