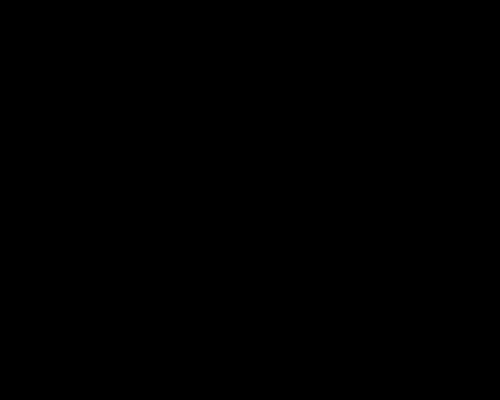Nach fünf Tagen geballter «Zürich liest»-Ladung verlassen wir unser Redaktionsbüro. «Licht aus» im Karl der Grosse. Aber natürlich nicht «Licht aus» im Blog: Alle Beiträge gibt es hier zum Nachlesen – ganz in Ruhe und im Hellen.
Schlagwort: Zürich liest
Edition Unik: Jenseits des «Weisch no»
«Sie haben noch nicht das Alter», raunt mir meine etwa 75jährige Nebensitzerin zu. «Man weiss ja nie», entgegne ich, «aber meinen Sie, es geht hier vor allem um das Alter?» «Nein, das Interessante ist ja das Konzept. Ich schreibe ja auch schon lange, aber ich brauche ein Konzept.» Und ein Konzept bekommt man hier. Die Edition Unik, 2014 von Martin Heller ins Leben gerufen, gastiert heute im Erkerzimmer des Zentrums Karl der Grosse. Es handelt sich bei der Edition um kein beliebiges Schreibprojekt, keinen Book on demand-Betrieb, keinen Kurs im literarischen Schreiben. Viel eher könnte man von einer Herausforderung sprechen: Wer am Projekt teilnimmt, der stellt sich der Aufgabe, in knapp siebzehn Wochen sein Leben literarisch zu ordnen, vielleicht: es auch literarisch zu verstehen. Mithilfe einer App treten Menschen mit ganz unterschiedlichem Lebenshintergrund in einen Schreibprozess ein – und am Ende steht dann ein Buch, von dem ein Exemplar als Zeitdokument bei der Edition verbleibt, zwei andere in den Besitz der Urheberin oder des Urhebers übergehen. So floriert in der Edition Unik in grossem Stil und erstaunlicher Breite eine Textsorte, die man mit Jean Paul eine «Selbsterlebensbeschreibung» nennen könnte. Und nicht nur von Einzeltext zu Einzeltext, sondern gerade in der Zusammenschau der Autobiographien könnte sich hieraus ein beeindruckendes Archiv des Psychologisch-Privaten für zukünftige Generationen ergeben.
Am heutigen Sonntag sind allerdings erst einmal die Jetzigen zahlreich versammelt, mehrheitlich Angehörige der Generation Ü60, unterwandert von einigen jüngeren Semestern. Auf dem Podium sitzen drei AutorInnen der Edition, namentlich Pia Tschupp, Sonja Casutt und Jürg Vogel, begleitet von Kindern und Enkeln, Jürg Vogel von seinem Vater. Es wird Persönliches, bisweilen Persönlichstes gelesen und deutlich wird, dass «sein Leben schreiben» für jeden etwas ganz anderes heissen kann. Für Pia Tschupp ist es das «Weben eines Teppichs von einem Anfang, an den man sich nicht erinnert, zu einem Ende, von dem man nichts weiss». Ihre Geschichte – die sie mit Tochter und Enkelin vorträgt – führt aus einer katholisch geprägten Jugend in der Innerschweiz über eine lange Tätigkeit als Lehrerin in Ghana zurück ins Fricktal. «Löcher» gibt es, beim Weben darf es die Geben (beim Lismen eben nicht), Briefe werden zitiert und in den Text integriert – da schafft jemand Ordnung.
Ganz anders nutzt Sonja Casutt das Konzept der Edition – nämlich als Protokoll einer strapaziösen Krankengeschichte. Seit dem siebzehnten Lebensjahr leidet Casutt an dissoziativen Krampfanfällen; das Leben mit der Krankheit und ihren Folgeerscheinungen zu schreiben, stellte eine enorm anstrengende, therapeutisch zugleich wichtige Aufgabe dar, verbindet sich mit diesem Krankheitsbild doch auch ein «Ausser-Sich-Sein», mithin ein Zustand, der sich erzählerisch gerade nicht mehr ohne weiteres fassen lässt. Nicht von ungefähr haben an Casutts Text auch ihre Kinder mitgewirkt, die ihrer Geschichte zugleich die Aussensicht stiften.
In humoristischen Anekdoten wiederum versucht Jürg Vogel seine Adoleszenz festzuhalten. Zwischen Skiliftanlage, Zahnarztbesuchen, Erinnerungen an das Kollegium Engelberg wird auch hier eine Vergangenheit erkennbar, die sich zu retten lohnt – und an deren Erzählung nicht nur Vogel, sondern auch sein Vater immer noch erkennbar Freude haben.
Zeuge wird man an diesem Nachmittag von der strukturierenden, ja vielleicht auch rettenden Kraft des Schreibens. Der literarische Anspruch muss und darf hier gerne zurücktreten, er wird an dieser Stelle gerade einmal nicht gebraucht. Die Bedürfnisse, die hier durch die Literatur gedeckt werden, sind vielmehr elementarer Natur. Und das kommt vor allem anderen.
Geschichten im Schwarzen Raum – Michael Fehr erzählt in der Blinden Kuh
Ein nebliger Sonntagmorgen, die Sinne schlaftrunken – zusammen mit Michelle und Seraphin betrete ich die «Blinde Kuh». Mäntel und Taschen werden eingeschlossen, Notizbuch und Handy abgenommen: festhalten, schreiben und fotografieren, das geht hier nicht – wir werden zu «richtigen» Zuhörerinnen. Obgleich die Dunkelheit der Nacht noch nicht weit zurückliegt, brauchen die Augen Zeit, um sich an das Schwarz zu gewöhnen. Um die süsse Erinnerung an den Schlaf zu bannen, bestelle ich mir einen Kaffee. Irgendwann erlangen die Hände eine Ahnung für den Raum.

Das Restaurant füllt sich, lebhafte Gespräche und das Klirren und Klappern der Teller und Gläser erinnern an eine normale Beiz. Die Dunkelheit ist nun nicht mehr beengende Abwesenheit, sondern schärft die Sinne für anderes, auch für Michael Fehrs Stimme, die alsbald den Raum einnehmen wird. Die Süppchen sind leer und die Häppchen weg, als der Lyriker uns mitteilt, dass seine erste Geschichte von Essen handle. Er erzählt von der Königin im Wald, von einer Schlange, die einen alten Mann verspeisen möchte, um ihre stattliche Postur zu bewahren. Sie prahlt ausufernd mit ihrer Schönheit, Grösse und Stärke, die so weit reiche, dass ein Stein von ihrem Biss zu bluten beginne. Der alte Mann verliert ob dieser Selbstinszenierung die Furcht und wagt es, sich von der Schlange zu entfernen. Das Publikum bleibt ratlos zurück, und Michael Fehr verkündet: «So ist die Geschichte fertig».
Er wolle bewusst offen lassen, ob die Schlange lüge oder die Geschichte ein Märchen sei, in der Steine zerbissen werden können. Darin liege gerade das Potential einer Erzählung: die Zuhörer in einem Schwebezustand zu belassen, der Vieldeutigkeit, nicht aber Beliebigkeit bedeute. Denn beliebig ist keine der Geschichten, die uns Michael Fehr an diesem Morgen erzählt. Ihre Sinnkonstruktionen entstehen zwar nicht durch das Abrufen bekannter Muster, aber durch Farben, Bilder, Klänge und Rhythmen.
Um das Publikum zu schonen, habe er mit einer «leichten» Geschichte begonnen, denn andere Texte erzählten expliziter von Gewalt. Ironisierende Distanz zu schaffen, wie er es sich sonst gewöhnt sei – durch Mimik und Gestik seiner zierlichen Statur – gelinge heute nicht. Im Dunkeln sind wir den Worten viel direkter, beinahe schonungslos ausgeliefert.
Doch die «Blindheit» öffnet vielleicht auch einen neuen Zugang zum Raum der Fantasie, für den der Lyriker an diesem Morgen plädiert. Das «westliche Schreiben» sei geprägt vom Psychologisieren und knüpfe an seine Tradition an. Aber vielleicht liege gerade im Mut, sich Neues auszudenken und zu schaffen und dabei das Anknüpfende, Erklärende in den Hintergrund zu rücken, eine wirkliche Kraft. «Ich war schon alt, als ich zu schreiben begann. Ich hatte keinen klaren Platz», sagt Michael Fehr. Durch das Erzählen, vielleicht auch sich selbst erzählen, kann man sich einen Platz schaffen, in Momenten wo man ihn nicht noch zu kennen meint. So brauche es oftmals nur einen kleinen Schritt, um sich zu lösen. Doch liege es in der Natur des Menschen, dass man diesen oft nicht gehen könne – wie der Protagonist in der Erzählung Im Schwarm, der in einer Sommernacht von Mücken zerstochen wird und es nicht schafft, sich aus dem Licht zu begeben.
Als ich die «Blinde Kuh» verlasse, fordert die grelle Sonne eine zweite Gewöhnung, doch die aus Dunkelheit geschaffenen Bilder vertreibt sie nicht. Und mir wird bewusst, dass es weder Stift noch Kamera braucht, um einen Zugang zu gewinnen. In erinnere mich an einen Satz von Kafka: «Die Vorbedingung des Bildes ist das Sehen», sagte Janouch, und Kafka erwiderte: «Man photographiert Dinge, um sie aus dem Sinn zu verscheuchen. Meine Geschichten sind eine Art von Augenschliessen.»
Die Schweiz haftet an Lewinsky
Charles Lewinsky wird bei seiner Lesung im Pfauen als Meister der Gattungen gepriesen. Vom Drehbuch übers Gedicht bis zum Roman liess er wenig unversucht. Und nun hat er sich erstmals an einen Krimi gewagt. Doch sein neues Buch «Der Wille des Volkes» ist vielmehr auch ein politisches Buch. Deshalb habe man die Lesung wohl auch von einem alternden Politiker moderieren lassen, meint der Alt-Regierungsrat Markus Notter augenzwinkernd.
Lewinsky zeichnet in seinem Buch das dystopische Bild einer Schweiz, die von Rechtspopulisten regiert wird. Es gibt darin nur noch sechs Bundesräte, da die eidgenössischen Demokraten eine solche Mehrheit im Parlament haben, dass sie den siebten Platz nur noch symbolisch für die Sozialdemokraten freihalten – um wenigstens den Schein einer Demokratie zu wahren. Unter diesen Umständen ist der pensionierte Journalist Kurt Weilemann dazu verdammt, nur noch Nachrufe schreiben zu dürfen, weil er die Verstorbenen ja «noch» gekannt hätte. Dabei werden ihm 1200 Zeichen für eine normale Leiche gewährt. Dass es sich beim Tod eines Kollegen nicht um eine solche, sondern um einen vertuschten Mord handeln muss, ist sich Weilemann sicher und beginnt – zum Widerwillen des Staates – zu recherchieren.
Um nichts von der Krimihandlung zu verraten, liest Lewinsky eher witzige, politisch brisante Stellen vor, die auch eindeutig die Stärke des Buches sind. Im Bezug auf die neuen Techniken sei das Buch auch in keiner Weise als Science-Fiction-Roman zu sehen, betont Lewinsky. Er beschreibt nichts, was es heute im Grunde nicht bereits gibt. Mit Ausnahme einer Rasiercreme, die man für ein glattes Kinnbloss aufzutragen brauche – das sei aber eher eine persönliche Wunschfantasie, wie der Autor verrät.
Auch die Lage des Journalismus beschreibe im Grunde die heutige Situation. Eine ziemlich pessimistische Aussicht laut dem Buch, in dem der alte Journalist von jungen Volontären verdrängt wird, die nicht mehr richtig schreiben könnten. Im Gespräch mildert Lewinsky sein Urteil etwas mit dem Begriff Umbruchszeit ab, in der die Zeitungen neue Funktionen finden müssen. Weil man heute die Infos bereits hat, wenn man die Zeitung aufschlägt, brauche es mehr Hintergründe oder neue Formate wie etwa das neue Projekt «Die Republik».
Die einzige Schweizer Zeitung, die in seinem Buch namentlich vorkommt und dabei nicht sehr gut wegkommt, ist «Die Weltwoche» – für die Lewinsky selbst einmal geschrieben hat. Er habe sich von Roger Köppel überreden lassen, ein Jahr lang wöchentlich einen Fortsetzungsroman zu schreiben. Dieser kam später unter dem Titel «Doppelpass» in Buchform heraus – nicht ohne Hiebe gegen die rechte Ausländerpolitik. Als seinen grössten Flop bezeichnet Lewinsky, dass er darauf kein einziges böses Mail bekommen hätte.
Nach ein paar Seitenhieben gegen die SRG («Entweder wird jodelnd gekocht oder kochend gejodelt») und einigen Sprichwörtern über Pessimisten, schliesst der Moderator Notter den Kreis mit einem passenden Geschenk, in Anlehnung an das neue Buchcover: Ein Ansteckwappen der Schweiz.
Mut zu Wahrheit und Tat – ein Portrait und Aufruf
Franziska Greising, die am Samstagabend in der Buchhandlung Beer zu Gast war, schreibt am liebsten über grosse Frauengestalten. So handelt ihr letztes Buch vom Leben Rösli (Rose) Näfs, oder, genauer gesagt: von vier Jahren dieses Lebens.
Rose kam ursprünglich aus dem Glarnerland. Da ihre Eltern wenig Geld hatten, verdingte sie sich als Aupair in Lugano, London und Genf und lernte so nebenbei Fremdsprachen. Als sie einen Bericht der SAG über die Judenverfolgung in Deutschland und Frankreich las, meldete sie sich sogleich zum Freiwilligendienst und wurde Leiterin eines Heimes mit 100 jüdischen Flüchtlingskindern im Süden Frankreichs. Als beinahe die Hälfte der Kinder, alle über 16 Jahre, verhaftet und ins Internierungslager nach Le Vernet gebracht wurden, war sie die einzige Fürsprecherin der Kinder. Das Rote Kreuz, als Organisation der das Kinderheim angehörte, und die Schweiz versagten ihr jegliche Un

terstützung. Da sie das Vertrauen in ihre Arbeitgeber verloren hatte, widersetzte sie sich deren Anweisungen und suchte Hilfe bei der Résistance. Der Polizeiminister von Vichy half ihr, die Kinder in letzter Minute aus dem Lager zu befreien. In Nacht- und Nebelaktionen und grüppchenweise schickte sie die Kinder in Richtung Genf. Die meisten von ihnen konnten die Grenze überqueren und fanden Zuflucht bei den von der SAG vermittelten Patenschaften. Viele von ihnen reisten weiter nach (damals) Palästina oder Amerika. Unter denjenigen, welche die traumatischen Erlebnisse verarbeiten konnten, nahmen sich nicht wenige jedoch später das Leben.
Greisings Buch widmet sich ganz dem eindrücklichen Mut und der aufopfernden Handlungsweise Rose Näfs. Wenn ihr Schreibstil sich auch sehr detailreich und dadurch auch etwas langatmig ausnimmt, so sorgte die Grundthematik jedoch für eine fesselnde Lesung, was durch die sich anschliessende lebhafte Frage- und Austauschrunde dokumentiert wurde. Viele Besucher konnten an Erzählungen ihrer Grosseltern anknüpfen; insbesondere die Rolle des Roten Kreuzes und der offiziellen Schweiz gab Anlass zu Diskussionen, aber auch der Aktivdienst an der Grenze für alle wehrtauglichen Männer.
Vieles von dem, was heute anklang, ist noch nicht aufgearbeitet und richtiggestellt, wird tabuisiert und totgeschwiegen, obgleich die Spuren der Schuld und die Traumata heute immer noch sichtbar sind. Dank Autorinnen wie Franziska Greising bleiben diese Missstände als solche jedoch in der Debatte. Bleibt zu hoffen, dass die Schweiz ebenfalls Mut zeigt und Verantwortung für ihre vergangenen, oder eben unterlassenen Taten übernimmt.
«Mord erlaubt»
Am 7. Oktober 2006 wurde die Journalistin Anna Politkowskaja im Treppenhaus vor ihrer Wohnung ermordet. Der Täter schoss fünfmal auf die Frau, die gerade ihre Einkaufstaschen trug – am Geburtstag des russischen Präsidenten Putin.
Was nach einem spannenden Theaterstoff klingt, beruht leider auf einer wahren Begebenheit. Die unerschrockene amerikanisch-russische Journalistin riskierte ihr Leben, indem sie kritische Reportagen über den Krieg in Tschetschenien, die Verbrechen der russischen Armee, Korruption und Folter schrieb. Ihr ist das Theaterstück «Anna Politkowskaja – Eine nicht umerziehbare Frau» gewidmet. In einem Monolog vermischt die Schauspielerin Kornelia Lüdorff Fakten aus dem Krieg mit Auszügen aus den Büchern und russischen Tagebüchern von Politkowskaja. Ihr letztes Buch trug den Arbeitstitel «Mord erlaubt». Sie wusste um die Gefahr, in der sie lebte, und wurde schon bald als «Feindin des russischen Volkes» Opfer eines Giftanschlags. Auch eine ihr ähnelnd sehende Nachbarin wurde erschossen. Doch Politkowskaja schrieb weiter. Bis zu ihrem Tod.
Es ist schwer zu fassen, dass diese erschreckende Geschichte, die in völlig reduzierter Form auf der Bühne erzählt wird, wirklich wahr ist. Trotz des nüchternen Zugangs über die Fakten, berühren und erschüttern die Auszüge aus Politkowskajas Büchern und die nacherzählten Dialoge – etwa mit einem abgebrühten 19-jährigen russischen Soldaten – bis aufs Tiefste. Wie eine einzige Schauspielerin diese tragische Geschichte auf der Bühne zum Leben erwecken kann, ist erstaunlich.
Ein Jahr nach der Ermordung schrieb der italienische Autor Stefano Massini diesen Monolog, der nun in einer Übersetzung in Zürich im Sogar Theater seine Erstaufführung feierte. Das Thema ist auch nach zehn Jahren noch hochaktuell. Kaum zwei Wochen ist es her, dass die regierungskritische Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta mit einer Autobombe ermordet wurde. Es sind Angriffe auf die Presse- und Meinungsfreiheit, die nicht zuletzt mit dem Rechtsrutsch in Europa eine unangenehme Dringlichkeit bekommen.
Im Interview nach der Aufführung erzählt die Schauspielerin Kornelia Lüdorff wie viel Respekt sie vor dieser Rolle hatte. Sie fragte sich, wie man einer solch mutigen Frau überhaupt gerecht werden könne. Es sei ihr schwer gefallen, nicht zu emotional an den Stoff heranzugehen, der bei den anfänglichen Proben immer wieder ins Dramatische zu kippen drohte. «Weg mit den Emotionen!», rief dann die Regisseurin Jennifer Whigham. Nicht die Schauspielerin dürfe sich die Erschütterung anmerken lassen, es sei vielmehr ihre Aufgabe, diese durch nüchterne Fakten beim Zuschauer hervorzulocken. Das Theater gibt solch politisch dringlichem Stoff einen Raum, indem sich der Zuschauer der Geschichte öffnet und ein nachhaltiger Eindruck zurück bleibt.
Genau dies ist im intimen Rahmen des kleinen Sogar Theaters an diesem Abend besonders zu spüren. Die anfängliche Erschütterung der Zuschauer von diesem schweren Thema weicht angeregten Diskussionen an der Bar. Anna Politowskaja lebt somit nicht nur im Theaterstück, sondern nun auch in der Erinnerung daran weiter.
«Wer liest hier überhaupt?!»
Passender hätte der Ort nicht gewählt sein können: Das Cabaret Voltaire – vor 100 Jahren die Keimzelle des Dadaismus – wird 2017 erneut zum Schauplatz literarischer Innovation. Das Literaten-Kollektiv AJAR (Association de jeunes auteurs romandes et romands) aus der Romandie präsentiert am Samstagabend seinen Roman «Unter diesen Linden», der in diesem Jahr in der deutschen Übersetzung erschienen ist. Das französischsprachige Original von 2016 hatte Aufsehen erregt, weil es nicht von einem, sondern von 18 Autorinnen und Autoren geschrieben wurde.
Im Cabaret Voltaire sind AJAR zu viert: Julie Mayoraz, Bruno Pellegrino, Lydia Schenk und Guy Chevalley stellen ihren Roman vor. Und sie sprechen nicht nur über ihn – sie führen auch vor, wie das Buch entstanden ist. Die vier Autoren setzen performativ Versatzstücke in zwei Sprachen zusammen. Eine beginnt auf Französisch, die nächste steigt auf Deutsch ein, später kommen die beiden anderen hinzu – bis alle zusammen puzzleartig einen Text vortragen, der erst in der Vielstimmigkeit Sinn ergibt.
In diesem Moment der mehrsprachigen, simultanen Darbietung scheint der Geist Tristan Tzaras durch die Gewölbe des Cabaret Voltaires zu wandeln: Das Echo des einst hier zusammen mit Richard Huelsenbeck und Marcel Janko vorgetragenen Simultangedichts «L’Admiral cherche une maison à louer » hallt im Wortgemisch AJARs eigentümlich nach. Die Idee der kollektiven Autorschaft – sie ist also bestimmt nicht neu. Aber sie scheint, zumindest im literarischen Kontext, immer wieder in Vergessenheit zu geraten. Im digitalen Zeitalter hat sich aber zumindest ihre Umsetzung erleichtert.
Mittels einer multimedialen Performance gibt AJAR Aufschluss über den eigenen Schreibprozess. Sie machen Musik auf einem kleinen Saiteninstrument, sprechen zeitgleich auf Französisch und Deutsch in Mikrofone und bilden auf der Leinwand ab, wie AJAR live an einem Word-Dokument arbeiten. Texte werden markiert, verändert, verschoben, erweitert, gekürzt, gelöscht. Dazu sind Aufnahmen zu hören, in denen die Autoren über ihre Arbeit sprechen.

«Es geht uns nicht nur um das Projekt Buch, sondern wir experimentieren mit verschiedenen Formen der Literatur.» Das wichtigste Ziel von AJAR sei die Auflösung der Autorschaft. Niemand wisse jetzt mehr, wer welche Teile zum fertigen Buch beigesteuert habe. Ab dem Zeitpunkt, zu dem man einen Textbaustein an alle sendet, sei das Kollektiv dessen Autor.
«Es geht uns nicht nur um das Projekt Buch, sondern wir experimentieren mit verschiedenen Formen der Literatur.»
Die von einem etwas irritierten Publikum gestellten Fragen werden von ihnen konsequent ignoriert. Sie antworten stattdessen mit starren Statements zu ihrer Arbeit. Ganz getreu ihres Credos: «La fiction n’est absolument pas le contraire du réel.» – «Die Fiktion ist absolut nicht das Gegenteil des Wirklichen.» In dem daraus entstandenen Roman «Unter diesen Linden» spielt die Autorschaft keinerlei Rolle mehr. Selbst die fordernde Frage eines Zuhörers, ob es sich bei der Erzählerin und Autorin Esther Montandon denn nun um eine fiktive Person handle oder nicht, muss offen bleiben. Am Samstagabend ist im Cabaret Voltaire 2017 der Autor ein weiteres Mal gestorben – um der Stimme des Kollektivs Platz zu machen.
Mirja Keller, Theresa Pyritz, Julien Reimer
Es bleibt dabei: die Gedanken sind frei!
In stimmungsvoller Atmosphäre, inmitten von anthroposophischen Büchern und roten, mit Namen versehenen Samtstühlen steht Patricia Litten und erzählt von den Gräueltaten der Nationalsozialisten, begangen an ihrem Onkel Hans. Dokumentiert sind diese im Buch ihrer Grossmutter, Eine Mutter kämpft gegen Hitler, aus dem Litten heute vorträgt:
Hans Litten war Rechtsanwalt. Er trat entweder als Verteidiger auf – wenn Kommunisten angeklagt waren; oder als Vertreter der Geschädigten – wenn Nationalsozialisten auf der Anklagebank sassen. Es war unvermeidlich, dass er zu Schaden kommen musste.
Hans war sehr erfolgreich und weithin geachtet wegen seiner forensischen Erfolge und stammte darüber hinaus aus einer angesehenen Familie. Dies rief natürlich auch Neid hervor, der sich bald zu Hass steigern sollte. Litten befragte Hitler selbst als Zeuge im Felseneck-Prozess zu Nazi-Terrorismus. Er wollte aufzeigen, dass die nationalsozialistische Partei Gewalttätigkeiten ihrer Mitglieder dulde, ja gar hervorrufe. Hitler zog sich damals aus der Affaire, aber Litten hatte ihm gehörig zugesetzt, was Hitler ihm nie vergessen sollte. Wohlbemerkt, dies war noch vor der Machtergreifung. Je mehr Macht Hitler erlangte, desto mehr Anwälte flohen. Litten war jedoch überzeugt:
Das Recht ist für die Schwachen, ich gehe keine Konzessionen ein. Millionen von Arbeitern können nicht raus, also muss ich bleiben.
In der Nacht des Reichstagsbrands wurde Hans in Schutzhaft genommen, zuerst im KZ Sonnenburg später in Lichtenburg, Buchenwald und Dachau. Während fünf Jahren war er ohne klare Anklage inhaftiert. Er wurde schwer misshandelt, körperlich und mental gefoltert. Als seine Mutter die Ärzte darauf ansprach, taten sie die Vorwürfe als natürliche Haftpsychose ab: er verletze sich selber um Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Mutter rief alle ihre Bekannten dazu auf, sich für Hans Litten bei Hitler zu verwenden. Sie besuchte diesbezüglich unter anderem den Reichswehrminister Herr von Blomberg, den Reichsjustizminister Güntner und den Reichsgerichtspräsidenten Freisler . Doch niemand konnte Hitler erweichen. Durch verschiedene Quellen erfuhr sie, dass durch grausame Misshandlungen Hans systematisch zum Selbstmord getrieben werden sollte.
Hans stand immer wieder in Briefkontakt mit seiner Mutter und durfte sie zwischenzeitlich als Besucherin empfangen. Die Briefe und Unterhaltungen waren natürlich verschlüsselt. Der Code flog mehrmals auf und es war schwierig die neuen Codes einander mitzuteilen. Einmal bat Hans um Gift. Unter Druck bekannte er sich Verbrechen schuldig, die er nie begangen hatte. Als Christ und Mensch mit grossem Moralverständnis konnte er jedoch nicht mit der Lüge leben. Er widerrief die Falschaussage und nahm das Gift um den angedrohten Konsequenzen eines Widerrufs zu entrinnen. Er überlebte nur knapp.
Trotz allem Leiden und obwohl er körperlich gebrochen war, blieb sein Interesse an seinen Mitmenschen und der Wissenschaft wach. Seine Kämpfernatur brach immer wieder hervor. Als die Gefangenen vom KZ Lichtenburg aufgefordert wurden ein nationalsozialistisches Fest zu feiern, trug Hans Litten ein Gedicht in Gegenwart der SS vor. Dies ist ein Ausschnitt daraus:
Und sperrt man mich ein
in finstere Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke.
Denn meine Gedanken
zerreissen die Schranken
und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei!
Am 5. Februar 1938 wurde bekannt, dass Hans Litten sich in Dachau erhängt hatte. Seine Beerdigung erfolgte ohne Aufsehen, anwesend waren lediglich seine Mutter, eine ihrer Freundinnen und der Organist.
Die Geschichte von Hans wurde verfilmt und als Theater aufgeführt. Seine Nichte spielte im Theaterstück Taken at midnight ihre Grossmutter. Patricia Litten ist auch verantwortlich für die Neuauflage des Buches mit einem neuen Nachwort. Am Ende der Lesung öffnet sie den Blick und verweist auf die Nachfahren von Hans Litten. Es sind dies Rechtsanwälte, die zwar nicht mit ihm verwandt, aber mit ihm im Kampf um das Recht verbunden sind, und nicht wenige teilen auch das Verfolgungsschicksal. Sie heissen, zum Beispiel, Abdolfattah Soltani aus dem Iran, Hüsnü Öndül aus der Türkei oder Zhou Shifeng aus China.
Es gibt keine schlechte Zeit, um Anwalt zu sein. Im Gegenteil, es ist eine grosse Zeit, die grossartige Anwälte gebiert. Anwälte, die Mut, Weisheit und Gewissen brauchen.
Die Geschichte von Hans Litten zeugt wie die Tagebücher von Anne Frank oder das Leben der Geschwister Scholl von erlittenem Unrecht und Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Darüber hinaus zeigt sie auf, dass auch Einfluss und Ansehen den Hass Hitlers nicht aufhalten konnten. Seine Geschichte bewegt die Anwesenden sicht- und hörbar. Dies ist nicht zuletzt auch der Präsentation durch die ausgebildete Schauspielerin Patricia Litten wie auch Birgit Förstner zu verdanken, die die Lesung auf ihrem Cello begleitete. Es war höchste Zeit, dass das Buch auch nach Zürich kam. Patricia Litten wuchs als Flüchtlingskind in Zürich auf. Ihr Vater Rainer, der Bruder von Hans, floh aus Deutschland und war sowohl als Regisseur als auch als Leiter des Theaters Am Central tätig.
Hans Litten wird zumindest auf dieser Welt kein Recht mehr widerfahren, aber auch heute noch braucht die Welt Rechtsprecher, die die Wahrheit über das eigene Wohlergehen setzen und gegen Unrecht einstehen. Möge das Wirken seiner geistigen Nachfahren erfolgreicher sein als seines.
7 Gründe, eine Tramlesung zu besuchen
- Es gibt keine schlechten Plätze, da es für einmal nicht darum geht die Autorin oder den Autor möglichst gut zu sehen, sondern bloss der Stimme zu lauschen – was dank Lautsprechern im ganzen Tram möglich ist.
- „Man kann sich durchschütteln lassen, entweder von der Geschichte oder vom Tram.“ (Zitat von Willi Wottreng bei der Lesung «Denn sie haben daran geglaubt»)
- Auch wenn einem die Handlung nicht umhaut, kann man eingelullt von der Vorleserstimme die Aussicht geniessen.
- Ohne sich den Kopf zu verrenken, kann auch mal die Reaktionen der gebannt zuhörenden oder vor sich hinträumenden Zuhörer beobachtet werden.
- Wenn das vorgelesene Buch in Zürich spielt, verweist die Autorin oder der Autor immer wieder spontan auf vorbeifahrende Schauplätze.
- Einmal Tram fahren ohne hektisches Ein- und Aussteigen.
- Weil endlich mal der Weg das Ziel ist.
Auf den Spuren von Robert Walser
Ganz überrascht steht die Stadtführerin Martina Kuoni vor den rund dreissig Neugierigen, die ihr heute auf den Spuren von Robert Walser durch die Stadt Zürich folgen möchten. Mit so vielen Besuchern hat die Germanistin wohl nicht gerechnet, die seit der Gründung von Literaturspur solche literarischen Stadtrundgänge zu ihrem Beruf gemacht hat.
Robert Walser war selbst ein begeisterter Spaziergänger und wanderte im Jahre 1896 zu Fuss von Stuttgart nach Zürich, wo er seine Laufbahn als Schriftsteller begann. Bis 1905 lebte er in verschiedenen Wohnungen in der Innenstadt, denen der Rundgang folgt – vom Grossmünsterplatz über die Schipfe, die Froschaugasse, dem Neumarkt und der Spiegelgasse bis zur Trittligasse. Walser zog nicht nur viel um, er liess sich bei der Schreibstube für Stellenlose in der Schipfe auch immer wieder neue Stellen als Schreibkraft vermitteln – unter anderen die Stelle in Wädenswil, die ihn zu seinem Roman «Der Gehülfe» inspirierte. Die Villa zum Abendstern, in der Walser selbst als Gehülfe bei der wohlhabenden Familie Dubler gewohnt hat und innerhalb eines halben Jahres deren Konkurs miterlebte, gibt es auch heute noch zu besichtigen.
Beim Spaziergang konnten sogar eingefleischte Zürcher neue Gassen entdecken – wie zum Beispiel die Robert-Walser-Gasse bei der St. Peterskirche – und Interessantes über den zu Lebzeiten wenig erfolgreichen Schweizer Autor erfahren. Etwa, dass Walser eigentlich Schauspieler werden wollte. Bei diesem Versuch soll ihn sein Bruder Karl Walser auf einer Aquarellzeichnung als Karl Moor aus Schillers «Die Räuber» verewigt haben. Die schlechte Resonanz auf seine schauspielerischen Versuche verarbeitete Walser schliesslich in «Die Talentprobe». Anders als Robert Walser war sein Bruder Karl zu Lebzeiten ein erfolgreicher Künstler, der sich als Wandmaler und Buchillustrator einen Namen verschaffte.
Dass Walsers letzter Wohnort für beinahe dreissig Jahre eine Heil- und Pflegeanstalt in Herisau war, wird beim Spaziergang nur kurz erwähnt. Doch diese befindet sich auch in dessen Heimatkanton und nicht in Zürich. Gerade weil hier keine Tafeln auf die Spuren Robert Walsers aufmerksam machen, eröffnete der literarische Spaziergang eine neue Sicht auf die verwinkelten Gassen Zürichs.