«Polonaise» nennt sich die Tanzpraxis, der man sich bedient, um uns in einen völlig verdunkelten Raum zu führen. Das Personal der Blinden Kuh geleitet zu unsichtbaren Tischen, serviert einen kleinen Apéro und steht mit Rat und Tat zur Seite, um sich in diesem verfremdeten epistemischen Zustand zurecht zu finden. Der Raum klingt nicht sehr gross, das Publikum riecht gespannt und das Porzellan in den Händen fühlt sich glatt und weiss an. Man wartet auf Michael Fehr, der hier in der Finsternis bald einige seiner Geschichten aus dem kürzlich erschienenen Band Glanz und Schatten lesen wird – so behauptet man zumindest. Ob der Autor wirklich da ist, bleibt im Dunkeln.
Wie kaum ein anderer erkämpft sich der Berner Autor mit seiner eindringlichen Stimme Präsenz in seinen Texten. Man kennt ihn als den Künstler, der in persona für sein Wort einsteht, umso irritierender ist es, wenn dieser Performer bei seinem Auftritt unsichtbar bleibt. Allerdings macht er das auch nicht zum ersten Mal.
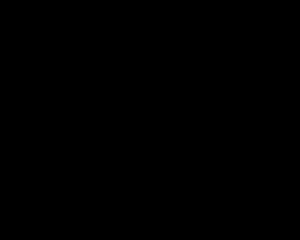
Eigentlich arbeite er oft mit Gesten und Mimik, wird er uns später in einem kurzen Gespräch erklären, Ausdrucksmöglichkeiten, die im Dunkeln entfallen, alles bliebe an der Stimme zu sagen. Seine letzte Geschichte beendet er sogar mit dem Hinweis, dass er die Arme zu einer beglückwünschenden Geste ausgebreitet habe – natürlich nicht ohne ein unübersehbares ironisches Augenzwinkern.
Wieder einmal beweist ein «Spoken-word»-Künstler, wie unscheinbar und ausdruckslos Wortwiederholungen sind, wenn sie tot auf dem Papier liegen bleiben. Es pulsiert, es lebt. Es ist eine Interaktion mit dem Hörer. Wer Michael Fehrs Texte kennt, dem fällt auf, dass sich der Autor nicht immer ganz an sein Gedrucktes hält. Er ertastet, was in welchem Publikum funktioniert. Da wird eine Phrase wiederholt, die der Text alleine stehen lässt und auch die Mücken in «Im Schwarm» haben heute öfters zugestochen als auch schon.



