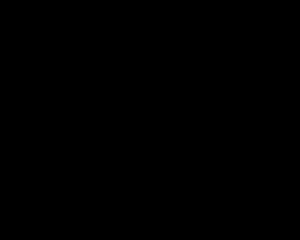Als ich zehn Minuten vor Lesungsbeginn das Cobratram am Bellevue betrete, ist der erste Eindruck schlimmer als bei einem blutrünstigen Krimi: Feierabendverkehr! Und das am Sonntagmittag kurz vor 12 Uhr. Und selbst im Krimitram, in dem die Zürcher «Sisters in Crime», Petra Ivanov und Mitra Devi, ihren gemeinsam verfassten Thriller «Schockfrost» präsentieren, werden die wenigen leeren Sitze von ziemlich grossen Handtaschen beansprucht. Ich ergattere einen der letzten Plätze, sogar einen mit ordentlich Beinfreiheit, dafür aber mit dem Rücken zu den Lesenden.
 Mich die ganze Zeit umzudrehen war dann doch zu mühsam, und so konnte ich die vorbeiziehende Innenstadt geniessen, während Devi nach der kurzen Anmoderation direkt zu lesen begann. Meine Sitzposition eröffnete mir immerhin, was den meisten anderen Zuhörern verborgen blieb: Unser Tram wurde, zumindest auf den ersten paar Metern, von einer Streife der Stadtpolizei Zürich eskortiert. Der Krimi-Mittag konnte beginnen.
Mich die ganze Zeit umzudrehen war dann doch zu mühsam, und so konnte ich die vorbeiziehende Innenstadt geniessen, während Devi nach der kurzen Anmoderation direkt zu lesen begann. Meine Sitzposition eröffnete mir immerhin, was den meisten anderen Zuhörern verborgen blieb: Unser Tram wurde, zumindest auf den ersten paar Metern, von einer Streife der Stadtpolizei Zürich eskortiert. Der Krimi-Mittag konnte beginnen.
Devi und Ivanov lasen abwechselnd Passagen aus ihrem Buch. Am Anfang war das etwas verwirrend und zusammenhangslos, doch Schritt für Schritt wurden die präsentierten Figuren in einen Kontext gestellt. Zwischen den Passagen erörterten die beiden Autorinnen immer wieder den Rahmen ihres Thrillers und zogen die nötigen Verbindungen zwischen den vorgestellten Figuren. So hatten wir etwa zur Hälfte der Lesung, beim Bahnhof Altstetten, langsam aber sicher ein Bild davon, was uns bei «Schockfrost» erwartet.
Während Devi beim Vorlesen eine unheimliche Stimmung heraufbeschwört, ist Ivanov das Gegenteil. Sie liest ruhig und langsam und schafft so einen Gegenpol zu Devi. Am besten kommt diese Kombination zur Geltung, als die beiden gegen Ende zusammen lesen: Ivanov übernimmt die direkte Rede der Psychiaterin Sarah, während Devi die Erzählinstanz und Sarahs Patienten Georg liest. Als dem unter Verfolgungswahn leidenden Georg während seiner Sitzung bei Sarah ein Küchenmesser aus der Jacke fällt, hält Ivanov inne. Sie klärt die Fahrgäste auf, dass die Kapitel eines Thrillers eigentlich immer mit einem Cliffhanger enden, so wie dieses hier. Ausnahmsweise würden sie heute und nur für uns noch eine Szene mehr lesen.
Doch die Freude über diese Grosszügigkeit ist nur von kurzer Dauer: Auch die nächste Szene endet mit einem mindestens so grossen Cliffhanger. Ivanov grinst verschmitzt und meint lediglich, dass sie ewig so weitermachen könnte. Überraschend war dann auch, dass die beiden Autorinnen, die bekannt für ihre Zürcher Krimis sind, den mobilen Lesungsort entgegen meinen Erwartungen nicht ausgenutzt haben. Die erzählten Passagen spielten irgendwo im Nirgendwo, während draussen die bekannteren Ecken Zürichs in voller Pracht erstrahlten. Trotzdem hat die Lesung Lust auf das Buch gemacht, doch das eigentliche Highlight folgte erst noch: Die beiden Autorinnen erörterten abschliessend noch, wie es ist, gemeinsam ein Buch zu schreiben.
Ivanov und Devi arbeiten schon lange zusammen. Bis anhin haben sie aber nur ihre Texte gegenseitig Korrektur gelesen. Der gemeinsame Thriller war ein Experiment, bei dem man sich alles andere als sicher war, ob das funktionieren kann. Während Devi Storyboards zu ihren Geschichten verfasst und alles genauestens plant, schreibt Ivanov lieber einfach mal drauf los und schaut dann, wie sich ihre Figuren entwickeln. Zu Beginn hat sich Ivanov durchgesetzt und sie haben einfach einmal drauf los geschrieben. Das hat einige Kapitel gut geklappt, doch dann musste für Devi ein Minimum an Planung her.
Das Wichtigste war den beiden, dass man am Ende nicht erkennen konnte, wer was geschrieben hat. Devi erklärte, sie hätte beim Überarbeiten die Teile Ivanovs «devisiert», während diese ihre Teile wiederum «ivanovisiert» hat. Das scheint funktioniert zu haben. Ihre Testleser, welche die Texte beider Autorinnen gut kennen, hätten nicht mehr herauslesen können, wer was geschrieben hatte.
Mühe hat den beiden Krimiexpertinnen dann noch der Schluss bereitet, denn sie hätten sich erst nicht darauf einigen können, wer sterben soll. Laut Ivanov sei dieses Sterben aber schliesslich doch sehr organisch passiert. Diese Aussage bringt das Publikum bereits zum Schmunzeln, doch Devi setzt noch einen drauf. Sie werden vielleicht wieder einmal zusammen ein Buch schreiben, meint sie, doch es werde ziemlich sicher keine Fortsetzung sein. Das wäre schwierig, denn dafür hätten zu viele Figuren den «Schockfrost» nicht überlebt.
 Vordergründig gibt sich das Buch als Agentenroman aus. Tatsächlich dreht es sich aber um alle möglichen Versionen der Täuschung und geht der Frage nach, wie Vertrauen zerstört wird. Natürlich folgt die Verdichtung der Lebensläufe den Regeln der Fiktion, aber «alle Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind mehr oder weniger so passiert», versichert Kraus.
Vordergründig gibt sich das Buch als Agentenroman aus. Tatsächlich dreht es sich aber um alle möglichen Versionen der Täuschung und geht der Frage nach, wie Vertrauen zerstört wird. Natürlich folgt die Verdichtung der Lebensläufe den Regeln der Fiktion, aber «alle Situationen, die im Buch beschrieben werden, sind mehr oder weniger so passiert», versichert Kraus.




 Mich die ganze Zeit umzudrehen war dann doch zu mühsam, und so konnte ich die vorbeiziehende Innenstadt geniessen, während Devi nach der kurzen Anmoderation direkt zu lesen begann. Meine Sitzposition eröffnete mir immerhin, was den meisten anderen Zuhörern verborgen blieb: Unser Tram wurde, zumindest auf den ersten paar Metern, von einer Streife der Stadtpolizei Zürich eskortiert. Der Krimi-Mittag konnte beginnen.
Mich die ganze Zeit umzudrehen war dann doch zu mühsam, und so konnte ich die vorbeiziehende Innenstadt geniessen, während Devi nach der kurzen Anmoderation direkt zu lesen begann. Meine Sitzposition eröffnete mir immerhin, was den meisten anderen Zuhörern verborgen blieb: Unser Tram wurde, zumindest auf den ersten paar Metern, von einer Streife der Stadtpolizei Zürich eskortiert. Der Krimi-Mittag konnte beginnen.