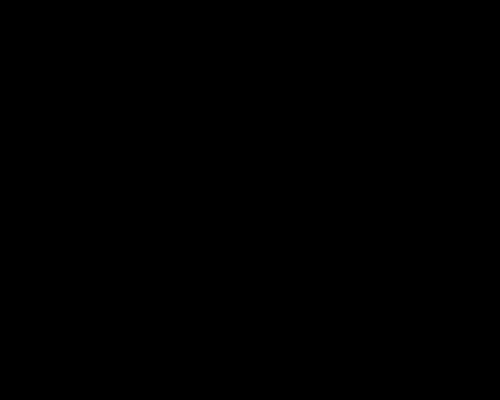Nach fünf Tagen geballter «Zürich liest»-Ladung verlassen wir unser Redaktionsbüro. «Licht aus» im Karl der Grosse. Aber natürlich nicht «Licht aus» im Blog: Alle Beiträge gibt es hier zum Nachlesen – ganz in Ruhe und im Hellen.
Kategorie: Allgemein
Edition Unik: Jenseits des «Weisch no»
«Sie haben noch nicht das Alter», raunt mir meine etwa 75jährige Nebensitzerin zu. «Man weiss ja nie», entgegne ich, «aber meinen Sie, es geht hier vor allem um das Alter?» «Nein, das Interessante ist ja das Konzept. Ich schreibe ja auch schon lange, aber ich brauche ein Konzept.» Und ein Konzept bekommt man hier. Die Edition Unik, 2014 von Martin Heller ins Leben gerufen, gastiert heute im Erkerzimmer des Zentrums Karl der Grosse. Es handelt sich bei der Edition um kein beliebiges Schreibprojekt, keinen Book on demand-Betrieb, keinen Kurs im literarischen Schreiben. Viel eher könnte man von einer Herausforderung sprechen: Wer am Projekt teilnimmt, der stellt sich der Aufgabe, in knapp siebzehn Wochen sein Leben literarisch zu ordnen, vielleicht: es auch literarisch zu verstehen. Mithilfe einer App treten Menschen mit ganz unterschiedlichem Lebenshintergrund in einen Schreibprozess ein – und am Ende steht dann ein Buch, von dem ein Exemplar als Zeitdokument bei der Edition verbleibt, zwei andere in den Besitz der Urheberin oder des Urhebers übergehen. So floriert in der Edition Unik in grossem Stil und erstaunlicher Breite eine Textsorte, die man mit Jean Paul eine «Selbsterlebensbeschreibung» nennen könnte. Und nicht nur von Einzeltext zu Einzeltext, sondern gerade in der Zusammenschau der Autobiographien könnte sich hieraus ein beeindruckendes Archiv des Psychologisch-Privaten für zukünftige Generationen ergeben.
Am heutigen Sonntag sind allerdings erst einmal die Jetzigen zahlreich versammelt, mehrheitlich Angehörige der Generation Ü60, unterwandert von einigen jüngeren Semestern. Auf dem Podium sitzen drei AutorInnen der Edition, namentlich Pia Tschupp, Sonja Casutt und Jürg Vogel, begleitet von Kindern und Enkeln, Jürg Vogel von seinem Vater. Es wird Persönliches, bisweilen Persönlichstes gelesen und deutlich wird, dass «sein Leben schreiben» für jeden etwas ganz anderes heissen kann. Für Pia Tschupp ist es das «Weben eines Teppichs von einem Anfang, an den man sich nicht erinnert, zu einem Ende, von dem man nichts weiss». Ihre Geschichte – die sie mit Tochter und Enkelin vorträgt – führt aus einer katholisch geprägten Jugend in der Innerschweiz über eine lange Tätigkeit als Lehrerin in Ghana zurück ins Fricktal. «Löcher» gibt es, beim Weben darf es die Geben (beim Lismen eben nicht), Briefe werden zitiert und in den Text integriert – da schafft jemand Ordnung.
Ganz anders nutzt Sonja Casutt das Konzept der Edition – nämlich als Protokoll einer strapaziösen Krankengeschichte. Seit dem siebzehnten Lebensjahr leidet Casutt an dissoziativen Krampfanfällen; das Leben mit der Krankheit und ihren Folgeerscheinungen zu schreiben, stellte eine enorm anstrengende, therapeutisch zugleich wichtige Aufgabe dar, verbindet sich mit diesem Krankheitsbild doch auch ein «Ausser-Sich-Sein», mithin ein Zustand, der sich erzählerisch gerade nicht mehr ohne weiteres fassen lässt. Nicht von ungefähr haben an Casutts Text auch ihre Kinder mitgewirkt, die ihrer Geschichte zugleich die Aussensicht stiften.
In humoristischen Anekdoten wiederum versucht Jürg Vogel seine Adoleszenz festzuhalten. Zwischen Skiliftanlage, Zahnarztbesuchen, Erinnerungen an das Kollegium Engelberg wird auch hier eine Vergangenheit erkennbar, die sich zu retten lohnt – und an deren Erzählung nicht nur Vogel, sondern auch sein Vater immer noch erkennbar Freude haben.
Zeuge wird man an diesem Nachmittag von der strukturierenden, ja vielleicht auch rettenden Kraft des Schreibens. Der literarische Anspruch muss und darf hier gerne zurücktreten, er wird an dieser Stelle gerade einmal nicht gebraucht. Die Bedürfnisse, die hier durch die Literatur gedeckt werden, sind vielmehr elementarer Natur. Und das kommt vor allem anderen.
Geschichten im Schwarzen Raum – Michael Fehr erzählt in der Blinden Kuh
Ein nebliger Sonntagmorgen, die Sinne schlaftrunken – zusammen mit Michelle und Seraphin betrete ich die «Blinde Kuh». Mäntel und Taschen werden eingeschlossen, Notizbuch und Handy abgenommen: festhalten, schreiben und fotografieren, das geht hier nicht – wir werden zu «richtigen» Zuhörerinnen. Obgleich die Dunkelheit der Nacht noch nicht weit zurückliegt, brauchen die Augen Zeit, um sich an das Schwarz zu gewöhnen. Um die süsse Erinnerung an den Schlaf zu bannen, bestelle ich mir einen Kaffee. Irgendwann erlangen die Hände eine Ahnung für den Raum.

Das Restaurant füllt sich, lebhafte Gespräche und das Klirren und Klappern der Teller und Gläser erinnern an eine normale Beiz. Die Dunkelheit ist nun nicht mehr beengende Abwesenheit, sondern schärft die Sinne für anderes, auch für Michael Fehrs Stimme, die alsbald den Raum einnehmen wird. Die Süppchen sind leer und die Häppchen weg, als der Lyriker uns mitteilt, dass seine erste Geschichte von Essen handle. Er erzählt von der Königin im Wald, von einer Schlange, die einen alten Mann verspeisen möchte, um ihre stattliche Postur zu bewahren. Sie prahlt ausufernd mit ihrer Schönheit, Grösse und Stärke, die so weit reiche, dass ein Stein von ihrem Biss zu bluten beginne. Der alte Mann verliert ob dieser Selbstinszenierung die Furcht und wagt es, sich von der Schlange zu entfernen. Das Publikum bleibt ratlos zurück, und Michael Fehr verkündet: «So ist die Geschichte fertig».
Er wolle bewusst offen lassen, ob die Schlange lüge oder die Geschichte ein Märchen sei, in der Steine zerbissen werden können. Darin liege gerade das Potential einer Erzählung: die Zuhörer in einem Schwebezustand zu belassen, der Vieldeutigkeit, nicht aber Beliebigkeit bedeute. Denn beliebig ist keine der Geschichten, die uns Michael Fehr an diesem Morgen erzählt. Ihre Sinnkonstruktionen entstehen zwar nicht durch das Abrufen bekannter Muster, aber durch Farben, Bilder, Klänge und Rhythmen.
Um das Publikum zu schonen, habe er mit einer «leichten» Geschichte begonnen, denn andere Texte erzählten expliziter von Gewalt. Ironisierende Distanz zu schaffen, wie er es sich sonst gewöhnt sei – durch Mimik und Gestik seiner zierlichen Statur – gelinge heute nicht. Im Dunkeln sind wir den Worten viel direkter, beinahe schonungslos ausgeliefert.
Doch die «Blindheit» öffnet vielleicht auch einen neuen Zugang zum Raum der Fantasie, für den der Lyriker an diesem Morgen plädiert. Das «westliche Schreiben» sei geprägt vom Psychologisieren und knüpfe an seine Tradition an. Aber vielleicht liege gerade im Mut, sich Neues auszudenken und zu schaffen und dabei das Anknüpfende, Erklärende in den Hintergrund zu rücken, eine wirkliche Kraft. «Ich war schon alt, als ich zu schreiben begann. Ich hatte keinen klaren Platz», sagt Michael Fehr. Durch das Erzählen, vielleicht auch sich selbst erzählen, kann man sich einen Platz schaffen, in Momenten wo man ihn nicht noch zu kennen meint. So brauche es oftmals nur einen kleinen Schritt, um sich zu lösen. Doch liege es in der Natur des Menschen, dass man diesen oft nicht gehen könne – wie der Protagonist in der Erzählung Im Schwarm, der in einer Sommernacht von Mücken zerstochen wird und es nicht schafft, sich aus dem Licht zu begeben.
Als ich die «Blinde Kuh» verlasse, fordert die grelle Sonne eine zweite Gewöhnung, doch die aus Dunkelheit geschaffenen Bilder vertreibt sie nicht. Und mir wird bewusst, dass es weder Stift noch Kamera braucht, um einen Zugang zu gewinnen. In erinnere mich an einen Satz von Kafka: «Die Vorbedingung des Bildes ist das Sehen», sagte Janouch, und Kafka erwiderte: «Man photographiert Dinge, um sie aus dem Sinn zu verscheuchen. Meine Geschichten sind eine Art von Augenschliessen.»
Die Schweiz haftet an Lewinsky
Charles Lewinsky wird bei seiner Lesung im Pfauen als Meister der Gattungen gepriesen. Vom Drehbuch übers Gedicht bis zum Roman liess er wenig unversucht. Und nun hat er sich erstmals an einen Krimi gewagt. Doch sein neues Buch «Der Wille des Volkes» ist vielmehr auch ein politisches Buch. Deshalb habe man die Lesung wohl auch von einem alternden Politiker moderieren lassen, meint der Alt-Regierungsrat Markus Notter augenzwinkernd.
Lewinsky zeichnet in seinem Buch das dystopische Bild einer Schweiz, die von Rechtspopulisten regiert wird. Es gibt darin nur noch sechs Bundesräte, da die eidgenössischen Demokraten eine solche Mehrheit im Parlament haben, dass sie den siebten Platz nur noch symbolisch für die Sozialdemokraten freihalten – um wenigstens den Schein einer Demokratie zu wahren. Unter diesen Umständen ist der pensionierte Journalist Kurt Weilemann dazu verdammt, nur noch Nachrufe schreiben zu dürfen, weil er die Verstorbenen ja «noch» gekannt hätte. Dabei werden ihm 1200 Zeichen für eine normale Leiche gewährt. Dass es sich beim Tod eines Kollegen nicht um eine solche, sondern um einen vertuschten Mord handeln muss, ist sich Weilemann sicher und beginnt – zum Widerwillen des Staates – zu recherchieren.
Um nichts von der Krimihandlung zu verraten, liest Lewinsky eher witzige, politisch brisante Stellen vor, die auch eindeutig die Stärke des Buches sind. Im Bezug auf die neuen Techniken sei das Buch auch in keiner Weise als Science-Fiction-Roman zu sehen, betont Lewinsky. Er beschreibt nichts, was es heute im Grunde nicht bereits gibt. Mit Ausnahme einer Rasiercreme, die man für ein glattes Kinnbloss aufzutragen brauche – das sei aber eher eine persönliche Wunschfantasie, wie der Autor verrät.
Auch die Lage des Journalismus beschreibe im Grunde die heutige Situation. Eine ziemlich pessimistische Aussicht laut dem Buch, in dem der alte Journalist von jungen Volontären verdrängt wird, die nicht mehr richtig schreiben könnten. Im Gespräch mildert Lewinsky sein Urteil etwas mit dem Begriff Umbruchszeit ab, in der die Zeitungen neue Funktionen finden müssen. Weil man heute die Infos bereits hat, wenn man die Zeitung aufschlägt, brauche es mehr Hintergründe oder neue Formate wie etwa das neue Projekt «Die Republik».
Die einzige Schweizer Zeitung, die in seinem Buch namentlich vorkommt und dabei nicht sehr gut wegkommt, ist «Die Weltwoche» – für die Lewinsky selbst einmal geschrieben hat. Er habe sich von Roger Köppel überreden lassen, ein Jahr lang wöchentlich einen Fortsetzungsroman zu schreiben. Dieser kam später unter dem Titel «Doppelpass» in Buchform heraus – nicht ohne Hiebe gegen die rechte Ausländerpolitik. Als seinen grössten Flop bezeichnet Lewinsky, dass er darauf kein einziges böses Mail bekommen hätte.
Nach ein paar Seitenhieben gegen die SRG («Entweder wird jodelnd gekocht oder kochend gejodelt») und einigen Sprichwörtern über Pessimisten, schliesst der Moderator Notter den Kreis mit einem passenden Geschenk, in Anlehnung an das neue Buchcover: Ein Ansteckwappen der Schweiz.
Davon, dass nicht immer alles verkehrt ist (aber das meiste schon)
In Yael Inokais neustem Werk Mahlstrom warten vergeblich: Adam, ein Tisch und ein Haus. Dass Adam dieser Beschäftigung zusammen mit zwei Gegenständen nachgeht, ist nicht weiter verwunderlich, wenn man einmal weiss, dass auch er ein Raum sein kann. Und zwar für seine Schwester: «Und ihr Raum war auch ich», begründet er fast triumphierend die Tatsache, dass Barbara vor ihrem Suizid nur ihm einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Sobald also Menschen zu bewohnbaren Räumen und Tische zu unter Schneedecken lastenden und von Pflanzen bekletterten Wartenden werden, hat die gleichzeitig wortwörtliche und metaphorische Verkehrung ins Dorfleben schon längst Einzug gehalten.
Inokai liest im Rahmen einer Sofalesung, deren Ziel es ist, gute Literatur «dringend sehr berühmt zu machen», wie es Marianne Bühler nennt, die den Abend einleitet. Nora Zukker führt das Gespräch mit Inokai, das sich zuerst um die Wahl der polyphonen Erzählperspektive dreht und um die Frage, ob man damit den einzelnen Figuren gerecht werden könne. Tatsächlich verhindert der Wechsel der Erzählfiguren gerade die endgültige Festschreibung eines Wissens hinsichtlich des Geschehens: So mag man – mit Nora Zukker – vermuten, dass der Selbstmord, der am Anfang des Werkes stehe, seine Begründung im Gefühl der Schuld von Barbara findet (die zusammen mit vier anderen Kindern einen Dorffremdling, Yann, beinahe totgeschlagen hat). Allerdings: Der Text gibt solch ein vorgefertigtes Wissen eben in keiner Weise preis.
Inokai liest eindringlich und bestimmt zuerst den Anfang, der beschreibt, wie ein ganzes Dorf nach der Selbsttötung eines Mädchens die eigene Sprache sucht und vorerst im Flüstern wiederfindet. Die Sprache wird durchgehend das grösste Problem bleiben: Man kann an ihr das Fremde erkennen (Yann spricht «Yannisch», wird als Mädchen beschimpft und versinkt am liebsten in Adams Armen) und damit ausgrenzen; man kann mit ihr aber auch ganze Geschichten zugunsten der eigenen auslöschen. Die Geschichte Barbaras muss dementsprechend genauso unerzählt bleiben wie die von Annemarie und Astrid. Sie alle werden von Nora, Adam und Yann nacherzählt und damit überschrieben. Erzählt wird folglich, wie Geschichten für sich selbst umgedeutet und so anderen weggenommen werden können. Dass Barbara wie ein Tier ertrinkt, wie es zu Beginn heisst, kommt dabei nicht von ungefähr: Inokai wird später auf Nachfrage in einer Haraway verpflichteten Denkweise erläutern, dass es weniger darum gehe, die prominent vorkommenden Hunde als Vermittlerfiguren zwischen Menschen zu verstehen, denen die Möglichkeit zur Verständigung abhandengekommen ist. Vielmehr seien die Tiere als alternative Ausformung von Sprache und Körperlichkeit zu denken, die in der menschlichen Sozialstruktur schlicht nicht sichtbar seien. Kinder und Tiere gleichen sich dabei in ihrer gleichzeitigen Überreglementierung und Gesetzeslosigkeit.
Mahlstrom ist damit jedenfalls vor allem: ein sehr kluges Nachdenken über Perspektiven (mit verblüffenden Wendungen). Yael Inokai erweist sich hingegen als eine Gesprächspartnerin, mit der man sich ohne Zögern am Sofa festzurren liesse.
Irreführender Titel
«Rezensionen auf keinen Fall mit einem Zitat beginnen», riet der Dozent und verwies auf die elektronisch erfasste Rezeptionsverweigerung, die solche Auftakte provozieren, wobei ja jeder weiss, dass der noch zögerliche Leser vorranging verschreckt wird durch Satzgebilde, die – zum Beispiel aufgrund von Parenthesen – zu keinem Ende finden. Zu meiner wie der Leserschaft Erleichterung wird die seriöse Berichterstattung zur Sofalesung mit Yael Inokai von Kollegin Brügger übernommen, demnach sei dieser Beitrag eine so kurze wie euphorische Laudatio auf die Gastgeber: ein Danke der Dame des Hauses für Speis & Trank, deren Güte zweifellos auch zu schätzen wusste, wer sich nicht am Monatsende durch Bohnendosen löffelt, und dem Hausherrn, aus dessen imposanter Bibliothek sich jeder Zuhörer einige Exemplare abgreifen durfte («Wer den ganzen Knausgård nimmt, bekommt eine Tüte dazu»). Gerührt von dieser Grosszügigkeit, etwas beschickert und überladen wie eine Ameise taumelte ich heimwärts und fand auf Höhe Langensteinenstrasse an einer gutbürgerlichen Hecke Halt.
Wer nun den Eindruck gewonnen hat, die Verfasserin sei leichter zu bestechen als ein Mitarbeiter des sizilianischen Hochbauamts, dem sei versichert: unbedingt! Ich empfehle es selber nachzuprüfen.
Unsichtbar – aber spektakulär
Den Menschen am Rande der Gesellschaft eine Stimme zu geben – dies ist das Ziel des Projektes «Invisible Philosophy» des Künstlerduos Stefan Baltensperger und David Siepert. Seit mehreren Jahren beschäftigen sie sich mit dem Thema Migration; passenderweise stellten sie ihre Arbeit im Rahmen von Zürich Liest im Travel Book Shop vor. Für ihre letztes Werk gingen sie in den Grossraum Peking und stellten für einen Tag lang Wanderarbeiter an – sogenannte «invisible people» -, um sich Gedanken über das Leben zu machen und diese auf Papier zu bringen. Die Bedingung: Sie mussten ernsthaft den ganzen Tag daran arbeiten. Zu ihrem Schutz versprachen ihnen die Künstler strikte Anonymität.
Baltensperger und Siepert haben darauf geachtet, Männer und Frauen aus verschiedenen Altersgruppen für ihr Projekt zu gewinnen. Die Arbeiter schrieben meist über Dinge, die sie persönlich bewegen: Familie, Gesundheit, Ausbildung, Geld und Gesellschaft. Ihre Geschichten sind oft berührend: Eine Frau berichtet davon, wie sie zuhause misshandelt wird und fotografiert am Ende des Tages ihren Text, um ihn ihrer Familie zu zeigen. Aber auch abstraktere Gedankengänge gibt es. «Society is too real» schreibt ein Mann, und ein anderer beklagt den Druck des Geldes, das alles bestimmt – selbst Gott sei nicht allmächtig ohne Geld. Einige kommentieren auch, dass dies das erste Mal seit Langem sei, dass sie sich Gedanken über das Leben machen könnten oder danach gefragt würden. Das Projekt entfaltete somit doppelte Wirkung – für viele der Arbeiter genauso wie für uns Betrachter, die wir mit neuen Perspektiven konfrontiert werden.
Die Künstler sprachen auch über die vielfältigen Schwierigkeiten, mit denen sie umgehen mussten. Viele Arbeiter trauten sich die Arbeit nicht zu. Anderen war das stundenlange Schreiben zu anstrengend. Und dann war da noch das Problem der Übersetzung: Viele Tagesphilosophen schrieben in Dialekt oder in simplifiziertem Chinesisch, dass nur schwer in Mandarin, geschweige denn ins Englische, übersetzt werden kann. Drei Übersetzer brauchten mehrere Durchgänge, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erreichen.
Diese Herausforderungen formten die Buch-Form, in der sie das Projekt publizierten. Maschinengeschriebene Übersetzungen in Mandarin und Englisch machen den Kern des Buches aus. Buchstäblich zwischen den Zeilen scheinen die originalen Abdrucke der Handschrift der Arbeiter durch: In japanischer Bindung wurden je zwei Seiten zusammengeklebt und die entstandenen Innenräume mit den Originaltexten bedruckt. Auch formell spiegelt das Buch somit den Facettenreichtum und die Komplexität des Projektes wieder. Die Arbeiter sind abwesend – unsichtbar – und gleichzeitig immer präsent.
Man kann sich dem Projekt «Invisible Philosophy» somit von vielen Seiten nähern. Man kann es als Denkanstoss nehmen, um über das Leben nachzudenken. Man kann darüber nachsinnen, wie sehr die Sorgen von chinesischen Wanderarbeitern den hiesigen ähneln. Und natürlich darüber, wie interessant es ist, den «unsichtbaren Menschen» zuzuhören. Dies ist der Verdienst dieser Arbeit von Baltensperger und Siepert: Sie macht das Unsichtbare sichtbar.
Geschichte und Geschichten
Im Gespräch mit Claudia Mäser, die für Bücher am Sonntag der NZZ zuständig ist, erzählt Eveline Hasler an diesem verregneten Sonntag, der einlud, es sich im NZZ-Foyer bequem zu machen, wie sie jeweils von der historischen Recherche zur literarischen Fiktion gelangt.
Bevor 1982 ihr erster Roman «Anna Göldin – Letzte Hexe» erschien, hat Eveline Hasler seit den 60er Jahren Kinder- und Jugendbücher geschrieben. Auf «Anna Göldin» folgten weitere historische Romane, wobei Hasler die Bezeichnung Roman nicht zusagt. Ihre literarischen Werke seien genre-mässig schwierig einzuordnen, basieren sie doch auf Fakten, die sie lediglich erzählerisch vermittle. Biografische Annäherung klinge jedoch auch seltsam, meint sie.
Die Vergangenheit fasziniert Hasler, die Geschichte studiert hat. Sich mit der Vergangenheit und Geschichte zu befassen und dies literarisch zu transponieren, stellt für Hasler eine Möglichkeit dar, Geschichten von früher – besonders von ungerecht behandelten und vernachlässigten Menschen wie Anna Göldin – zu transportieren. Ein Akt der Gerechtigkeit: Die Vergangenheit sei schliesslich nicht trennbar von der Gegenwart.
Wie geht man nun jedoch vor, wenn man aus einer riesigen Faktensammlung einen literarischen Text schreiben möchte? Es sei sehr aufwändig, antwortet Hasler. Anderthalb Jahre betreibe sie Recherche, um sich dann nochmals anderthalb Jahre dem literarischen Schreiben zu widmen. Der Beginn des Schreibens sei schliesslich das Schwierigste, denn wie entscheidet man, welche Szenen essentiell sind für die jeweilige Begebenheit? Ihre Verlegerin habe mal zu ihr gesagt: «Du musst alles wieder vergessen, was du gelesen hast.»
Erst mit einem distanzierten Blick sei es ihr deswegen möglich, die Geschichte zu visualisieren und sie dann niederzuschreiben. In ihrem nächsten Leben würde sie gerne Filmemacherin werden, meint Hasler lachend: „Das würde mir glaubs gefallen.“
Dass Hasler gerne Geschichten erzählt, merkte man an ihren oft ausschweifenden Antworten. So musste Mäser sie dann auch am Ende knallhart unterbrechen: gerade, als sie vom Abschnitt, den sie aus «Anna Göldin» vorlas – unter anderem ging es dabei um das Suchinserat für Anna Göldin, das 1782 in der NZZ gedruckt wurde – plötzlich noch einen umgekehrten Vergleich zur Königin von England ziehen wollte und von da weiter zu…wie dem auch sei. Geschichte schreibt schliesslich Geschichten.
Sci-Fi trifft auf Phantastik im Sachbuchverlag
Autorenkollektive scheinen im Trend zu sein. Mit »AJAR« und »Gravity Assist« sind gleich zwei bei »Zürich liest’17« vertreten. Doch was kommt dabei heraus, wenn ein Unternehmensberater gemeinsam mit einem Account-Manager, einer Psychologin, einem Augenarzt und einer Kommunikationsspezialistin ein Buch schreibt, das diese »selber gerne lesen würden«? Eine Antwort darauf bietet der Debütroman des Autorenkollektivs »Gravity Assist«.
Zu hören waren sie an der Alderstrasse 21, dem Verlagssitz von rüffer & rub. »Seit 17 Jahren machen wir hier tolle Bücher.« Damit eröffnet ihre Verlegerin Anne Rüffer den Anlass. Zunächst thematisiert sie mit den Beteiligten den Entstehungsprozess der »Schwarzen Harfe« – so der Titel des Romans. Mit Nachdruck würdigt sie den 18-monatigen Entstehungsprozess und ruft zum Applaus auf. Der Hauptautor Stefan Bommeli offenbart im Gespräch, er habe schon immer den Wunsch gehegt einen phantastischen Roman zu schreiben. Im Schreibprozess hat er allerdings gemerkt, dass er für sein ehrgeiziges Projekt Unterstützung benötigen würde. Kontinuierlich hat sich Bommeli so Menschen und Kompetenzen an Bord seiner Raumfähre geholt. Zuerst den Freund aus Studientagen, dann die Ehefrau, den Schwager und eine weitere Vertraute. Es sei eh immer um den Roman gegangen, meint Berenice Bommeli. Da habe sie immerhin mitbestimmen wollen.
Die Autoren betonen das Gewicht einer einheitlichen Logik, stimmiger Psychologie und der Anschlussfähigkeit an unsere Welt und sind zuversichtlich, diesen Ansprüchen in ihrem Buch gerecht geworden zu sein. Rüffer gar lässt diesbezüglich keine Zweifel gelten. In der Auseinandersetzung mit dem rot-weiss gestreiften Untier namens »Kupran« offenbart das Kollektiv jedenfalls Phantasiereichtum. Im Gespräch berichten die Debütierenden von ihrer jeweiligen Lieblingsfigur, mit der sie sich stark identifizieren. Sie bezeichnen diese teilweise sogar als ihr »alter Ego«. Das Genre in dem sie schreiben, scheint also Tendenzen in Richtung Auto-Science-Fiction aufzuweisen. Zudem wirken auch tatsächlich romantische Motive hinein. Vielleicht hilft dabei ja der Umstand, dass einer der Koautoren ein Hoffmann im Doppelnamen führt. Als solches phantastisch-romantisches Element erscheinen im Roman metaphysische Träume und die brüchige Grenze zwischen Sinn und Wahn wird neu verhandelt. Die Verbandlung der oft gegeneinander ausgespielten Genren Sci-Fi und Phantastik scheint mithin das grösste Potential für wirklich Neues zu bieten – so die Hybridisierung denn gelingt!
Vergegenwärtigt man sich nochmals, dass Rüffer & Rub eigentlich Sachbücher macht, lassen sich die eingebauten Auszüge aus dem fiktiven »Illban-Allmanach« fast schon als wissenschaftssatirischen Impetus lesen. Vieles im Roman erinnert an bekannte Geschichten der Reverenzgenren. So gibt es etwa auch in der »Schwarzen Harfe« eine Spezies mit zurückgefahrenen Emotionen oder gar eine (Ring-)Handelsföderartion. Im Gespräch zeigt sich Stefan Bommeli bescheiden. Er ist sich bewusst, dass Frank Herberts »Dune«-Reihe, die er bewundert, einen sehr hohen Referenzpunkt abgibt und es anmassend wäre, den eigenen Roman in eine Linie damit zu stellen. Die Verlegerin hingegen verspricht sehr viel und legt dem Publikum das Buch demonstrativ nahe. Ob der Roman über die Standards eines epigonenhaften Machwerks hinausreicht, wird sich mit Beginn der Lektüre zeigen.
«Ich gehe in den Wald und schreie die Bäume an»
Sonntagmittag im Strauhof. 18 erwartungvolle Literaturfreunde haben sich in den Räumen der James-Joyce-Foundation zu einem Workshop eingefunden, um eine Antwort auf die vielgestellte Frage zu bekommen: «Wie können Sie sich so viel Text merken?» Eine Frage, die der Schauspieler und Regisseur Lukas Waldvogel oft zu hören bekommt. Und auf die er den Teilnehmern eine Antwort zu geben versucht. «Rilke auswendig lernen» heisst der Workhop und das passt – im Strauhof ist gerade die Ausstellung «Rilke und Russland» zu sehen.
Waldvogel berichtet von der Kunst des Memorierens im alten Griechenland. Die Verschriftlichung von Texten war nicht alltäglich, Texte mussten daher auswendig gelernt werden. Dafür gab es eine beliebte Technik: Die Redner konstruierten mentale Landschaften, wo sie den Orten bestimmte Themenkomplexe zuordneten. Während des Vortrags liefen sie durch ihre Landschaften und riefen sich so den Inhalt der Rede ins Gedächtnis.

Diesen Tipp gibt Waldvogel auch den Workshop-Teilnehmern: Bauen Sie sich eine Welt mit dem Text, den Sie lernen wollen. Dafür bieten sich starke Bilder an – je stärker, desto besser. Zunächst muss man aber versuchen, den Text zu verstehen. Waldvogel empfiehlt, dabei alles Vorwissen zu «vergessen» und ganz neutral an den Text heranzugehen.
Das erproben die Teilnehmer an Rilkes Gedicht «Abend» und tauschen in der Runde ihre mentalen Landschaften aus. Diese sind sehr unterschiedlich: Die eine Frau sieht einen baumumstandenen See vor sich, ein Mann dagegen einen Garderobenständer mit verschiedenen Mänteln. Eine andere Teilnehmerin denkt ans Theater und die nächste an ganz abstrakte Ortschaften. Waldvogel ermutigt die Gruppe, individuelle Zugänge zum Text zu finden. Schön zu wissen: Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch.
Zusammen mit einem Partner erarbeiten sich die Teilnehmer dann Rilkes Gedicht. Sie tragen es sich gegenseitig vor und ergänzen bei jedem Durchgang ein Stück mehr. Am Ende des Workshops schaffen es die meisten, die erste Strophe auswendig zu rezitieren. Für den Rest können sie nun Waldvogels Geheimtipp beherzigen: «Ich gehe in den Wald und schreie die Bäume an.»
Theresa Pyritz, Julien Reimer

Jetzt sind Sie dran, versuchen Sie’s!
Abend
Der Abend wechselt langsam die Gewänder,
die ihm ein Rand von alten Bäumen hält;
du schaust: und von dir scheiden sich die Länder,
ein himmelfahrendes und eins, das fällt;
und lassen dich, zu keinem ganz gehörend,
nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt,
nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend
wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt –
und lassen dir (unsäglich zu entwirrn)
dein Leben bang und riesenhaft und reifend,
so daß es, bald begrenzt und bald begreifend,
abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.
Rainer Maria Rilke