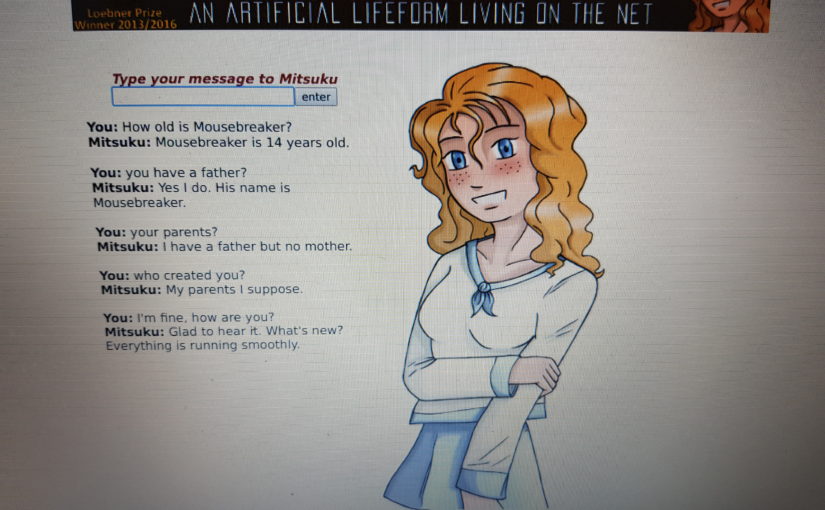Bei seiner Kurzlesung am Freitag war Adam Schwarz noch etwas beeinflusst vom Rotwein, der beim Eröffnungsapéro ausgeschenkt wurde. Heute ist es vor allem der Mangel an Koffein, der ihm noch etwas zu schaffen macht. Trotzdem entspinnt sich ein interessantes Gespräch rund um seinen Roman Das Fleisch der Welt, seinen Eindruck von den Solothurner Literaturtagen und warum er lieber ein Geschichtenerzähler am Lagerfeuer wäre.
Adam Schwarz, erstmal vielen Dank, dass Du dem Buchjahr erneut Red und Antwort stehst. Was war denn dein Highlight an den Solothurner Literaturtagen bis jetzt?
Ich hatte ehrlich gesagt noch fast keine Zeit für den Besuch von Lesungen. Ich hab unterschätzt, wie viel Zeit meine Auftritte und spontane Gespräche fressen. Zwei Lesungen hab ich aber besucht. Einmal die von John Banville, dem irischen Autor, den ich nicht gekannt habe, aber toll fand. Und zweitens die Lesung von Gion Mathias Cavelty, bei der ich bereits wusste, was mich erwartet und gut unterhalten wurde. Die paar Sachen, die ich mir vorgenommen habe, hab ich nicht geschafft. Ich hab selber noch ein paar Auftritte und gleich treffe ich mich mit der Moderatorin der Lesung von morgen.
Wie bereitest Du dich denn auf Lesungen vor?
Mit der Moderatorin von morgen hatte ich im Voraus E-Mail-Kontakt. Sie war auch schon an einer meiner Lesungen und wir werden sicher kurz besprechen, welche Aspekte sie gerne aufgreifen möchte. Das ist schon angenehmer so, dann wird man nicht ins kalte Wasser geworfen. Das war auch bei meiner bisher krassesten, weil grössten Lesung in der Schweizer Botschaft in Berlin so. Da hat mir der Moderator im Voraus seine Fragen unterbreitet. Ich bewundere die Autoren, die das alles schon länger machen und auf der Bühne total souverän wirken. Bei der Kurzlesung gestern fand ich es allerdings ganz angenehm, da begegnet man den Leuten fast auf Augenhöhe.
Ist das nicht schwieriger?
Ich weiss nicht warum, aber ich mag das sehr. Formate wie Sofalesungen zum Beispiel. Da hat man das Gefühl man sei ein Geschichtenerzähler am Lagerfeuer. Ich bin schliesslich kein Grossautor, sondern einfach einer, der ein Buch geschrieben hat.
Dann macht dich der ganze Trubel in Solothurn noch etwas nervös? Du bist also noch kein alter Hase?
Nein, ich glaub das dauert noch eine Weile. Ich finde es aber wichtig, mit den Leuten, die meine Bücher lesen, in Kontakt zu treten. Man schreibt schliesslich nicht nur in seinem stillen Kämmerlein. Das hat auch seine schönen Seiten. Wenn Leute mir berichten, was sie beim Lesen gedacht, gespürt, gefühlt haben, wenn mein Text anders zu meinen Lesern spricht als zu mir – das ist toll und spannend. Ich entdecke dann selber Dinge, die ich im Roman bisher nicht gesehen habe. Ich hoffe auch, dass noch mehr Gespräche und Reaktionen zu meinem Roman kommen, der mir selber fast schon etwas fremd geworden ist. Schliesslich ist es doch einige Zeit her, seit er erschienen ist und dazwischen ist viel passiert. Ich bin gespannt, wie ich in fünf, in zehn Jahren über meinen Roman urteilen werde. Ich fürchte, dass ich mir denken werde „Was hast du denn da für einen Mist geschrieben?“ Aber das muss wohl so sein.
Du hast erwähnt, dass Du an etwas Neuem arbeitest. Wie schwierig oder einfach ist das?
Es ist auf jeden Fall total anders jetzt. Es ist viel schwieriger, die imaginierte Öffentlichkeit auszuklammern. Ich will nicht schon beim ersten Entwurf denken „Ah ja, das schreib ich, das verkauft sich“ – eigentlich sollte man das nie denken. Für mich ist es wichtig, mich fürs Schreiben zurückzuziehen, mich vom Alltag abzugrenzen, vor allem da ich in Leipzig Philosophie studiere und nicht jederzeit schreiben kann. Das ist aber auch gut so. Ich mag es, Texte liegen zu lassen, damit sie gären. Meist konzentriert sich mein Schreiben deshalb auf die Semesterferien. Zum Beispiel war ich im März in Split, einem Ort an dem ich niemanden kenne und für mich bin – das hilft eine Routine zu entwickeln. So komme ich dem Gefühl am nächsten, das ich schon als kleines Kind hatte, wenn ich Legoklötze aufeinander stapelte und dazu Geschichten erfand.
Als Du die Idee für deine Geschichte hattest, schwebte dir da schon zu Beginn ein Roman vor?
Ja, aber ich habs für mich im Geheimen gemacht. Zwei oder drei Jahre hab ich niemandem davon erzählt. Erst in der Schreibwerkstatt des Aargauer Literaturhauses hab ich mal einen Ausschnitt zur Diskussion gestellt und gemerkt, dass das ankommt und Potential hat.
Die Idee für Das Fleisch der Welt kam dir auf einer Spanien-Rundreise und einer Flüeli-Ranft-Wanderung. Danach hast Du dich intensiv mit Niklaus von Flüe beschäftigt. Bist Du von Natur aus neugierig und gehört das zum Autorensein dazu?
Es gibt bestimmt verschiedene Arten von Neugier. Bei mir ist es eher eine „nerdige“. Ich interessiere mich für Vieles ein bisschen und sammle aus allen möglichen Gebieten. Ich kombiniere gerne abseitige Dinge und erfreue mich an sinnlosem Wissen und Anekdoten, die ich in meine Texte einbringen kann. Das hab ich in diesem Roman gemacht und werde es im nächsten Buch bestimmt genauso tun. Zum Beispiel der Ulrich, der meist nur Flüe-Experten bekannt ist. Der ist einfach so absurd, wie er Niklaus von Flüe nachzuahmen versucht und kläglich scheitert.
Apropos Ulrich: Philipp Theisohn meinte im letzten Interview, die Figur des Ulrich mache ihn aggressiv. Ich fand ihn hingegen eher witzig. War dieser Humor beabsichtigt?
Ich fand ihn auch eher witzig. Vor allem machte es grosse Freude, über ihn zu schreiben. Dieser nervige Mitläufer, der sich trotz allem sehr wichtig nimmt. Ich kann aber auch verstehen, wenn man wütend wird. Im echten Leben würde mich ein solcher Typ auch wütend machen.
Das Bild der damaligen Zeit ist ansonsten sehr düster. Ist das dein Eindruck vom Mittelalter?
Hm, schwierig. Es gibt natürlich dieses Mittelalterklischee, dass es finster war, düster und schlecht. Das wird dieser Zeit aber nicht gerecht. Letzten Endes war es einfach erforderlich für die Geschichte. Es hat sich so ergeben, weil ich diesem Ideal von Flüe, der versucht in eine geistige Sphäre zu gelangen, etwas Erdiges entgegenstellen wollte.
Dein Roman ist kein historisch akkurater. Schlägt dein neues Projekt eine ähnliche Richtung ein?
Wenn man nur Das Fleisch der Welt gelesen hat, denkt man vielleicht, das ist mein Hauptinteressensgebiet. Ganz im Gegenteil! Meine bisherigen Texte haben alle in der Gegenwart gespielt oder sogar eher in der Zukunft. Mich hat bei Das Fleisch der Welt nicht interessiert, wie es wirklich damals war. Ich wollte vielmehr das Potenzial dieser Situation herauskitzeln und schauen, was passiert. Es war eine Art Gedankenexperiment, das es meines Wissens bisher nicht gab. Mein neues Buch spielt wieder in der Gegenwart. Was bleiben wird, ist sicher das Absurde und das Zusammenbringen verschiedener Dinge.
Adam Schwarz, danke für das Gespräch!