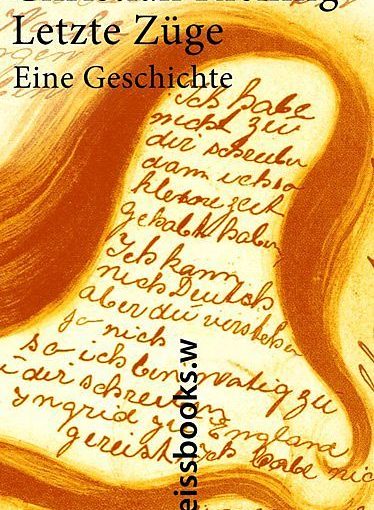Im Landeshaus diskutieren der Literaturprofessor und unlängst als Prosaautor hervorgetretene Christian Kiening und die Autorin Alice Grünfelder über das Dokumentarische in der Literatur. Eigentlich müsste es ja das Dokumentarische im Literarischen heissen, sagt der Moderator, denn was wäre von der Literatur noch übrig, würde das Dokumentarische fehlen?
Grünfelder und Kiening haben Passagen aus dem Buch der bzw. des anderen ausgewählt, die sie gegenseitig vorlesen und diskutieren. Eine sehr nette Idee, die auch andernorts schon versucht wurde, und die hier auch prächtig aufgeht: Beide vermitteln dem Publikum nicht nur einen guten Einblick in ihr Werk, sondern gehen auch konkret und kundig auf das Werk des Gegenübers ein.
Dokumentarische Literatur bemüht sich idealerweise, auch Widersprüchlichkeiten darzustellen – wenn etwa die vermeintliche Authentizität der Dokumente gar nicht dem entspricht, was Betroffene sehen, oder woran sie sich bruchstückhaft erinnern. Wie sehr Wahrnehmen und Denken von Kienings Grossvater etwa von seinen Bibel- und Rilkelektüren beeinflusst waren, das stellt kein noch so authentisches amtliches Dokument so recht scharf. Diesem Anteil, den die Imagination schon dort hat, wo man beginnt eine Geschichte für die eigene Erfahrung zu erzählen, kann erzählende Literatur vielleicht besser gerecht werden, als das klassische Sachbuch. Vielleicht, so kristallisiert sich heraus, ist das Entscheidende nicht, was gewesen ist, sondern wie man es sich erzählt.
Eine regelrechte Mogelpackung sei ihr Roman, sagt Alice Grünfelder, gerade weil es um die Möglichkeiten, Grenzen und Schnittstellen von Sachliteratur und Erzählfiktion geht. Ein Roman erreiche nun eben mehr Leute als ein Sachbuch zum gleichen Thema. Es geht immerhin auch um einen Themenkomplex – jüngere chinesische Geschichte – , der vielen hierzulande gänzlich unbekannt ist.
Der Versuch, dokumentarisch zu werden, führt dazu, dass man imaginativ die Lücken zwischen den Dokumenten füllen muss. Gerade wenn man versucht authentisch zu sein, wird auch die Imagination freigesetzt, so lautet dementsprechend eine dialektische Pointe, die im Verlauf des Gesprächs immer mehr Kontur gewinnt.
Darf Literatur missbraucht werden, um politisch-gesellschaftliche Inhalte zu kommunizieren? Und schliesslich ein generelles Misstrauen gegenüber der Fiktion: Besänftigt die Literatur nicht, wenn sie politisch Dringliches in das Gewand der Fiktion kleidet?
Das ist viel und dicht. Doch auch ganz ungeachtet der diskutierten Inhalte freut man sich hier aber auch darüber, wie sorgfältig und interessiert die beiden an den fremden Texten entlangdenken.
Dem Dokumentarischen ist nicht einfach zu trauen, dabei sind sich beide Parteien einig. Doch Kiening betont, dass man nicht einfach resignieren soll, weil man nie wissen kann, wie etwas tatsächlich vor sich gegangen ist. Dokumente zeigten nämlich auch eine Realität auf. Sie zeigen, wie man über etwas gedacht hat, das geschehen ist. Es sei vielleicht nicht wichtig, herauszufinden wie es wirklich war, sondern anzusehen, wie man sich etwas erzählt.