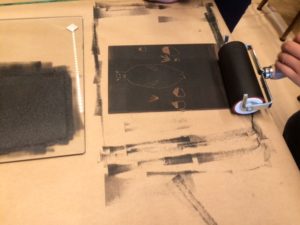Ob es ein unglücklicher Zufall oder symptomatisch gewesen ist, dass die Ehrung Mariella Mehrs nicht nur im Uferbau-Kino, sondern auch im Schatten der Verleihung des Solothurner Literaturpreises anberaumt wurde, ist nicht mehr zu entscheiden. Festzuhalten bleibt indessen, dass trotz der ungünstigen Platzierung viele, sehr viele gekommen sind, um der Hommage, die Corina Caduff, Christa Baumberger und Nina Debrunner vorbereitet hatten, beizuwohnen. In Anwesenheit der Geehrten begann Günter Baumann mit den ersten Zeilen aus Mehrs 2002 erschienenem Roman Angeklagt:
Ich bin im Zustand der Gnade. Ich töte. Ich bin.
Gehören diese Worte im Roman der sicherheitsverwahrten Brandstifterin und Mörderin Kari Selb, so stellen sie an diesem Morgen doch bereits die Weichen: Im Folgenden wird über Gewalt geredet werden müssen. Das ist für sich genommen nicht so schwer, denn der Opferdiskurs, wie ihn jüngst Svenja Goltermann so instruktiv wie gründlich durchleuchtet hat, ist allgegenwärtig und – das klingt seltsam und ist es auch – besitzt auch eine auffällige Publikumsattraktion. Solange man die Rede über Gewalt so kodiert, dass sie in uns die Befriedigung erfüllt, im Lesen, Hören und Sehen selbst Opfer gewesen zu sein, stört diese Rede nicht.
Mariella Mehr ist sich zeit ihres schriftstellerischen Lebens der Problematik dieser Kodierung bewusst gewesen, handelt es sich dabei doch um ein Leben, das durch den marginalisierenden Blick auf das Opfer bestimmt gewesen ist. Nahezu unmöglich bleibt es Mehr, Dichterin – und sonst nichts – zu sein. Ihre Biographie legt sich wie Blei auf die Wahrnehmung ihrer literarischen Produktion. Immer ist sie zuerst das Mädchen, das die Aktion «Kinder der Landstrasse» seinen Eltern entrissen und letztlich in eine jahrzehntelange Tortur geschickt hat, dann ist sie die Jenische – und irgendwann dann ist sie auch noch Autorin. Das ist nicht nur peinlich, sondern im Horizont von Mehrs Poetologie auch vollkommen falsch. Nirgends stellen ihre Texte das Erleiden pathetisch aus, nie betteln sie um Empathie. Es sind Geschichten auf dem Weg zur Tat, zum Sein im Schlag. An einer wichtigen Stelle des Gesprächs schaltet sich Mehr – ohne Mikrophon nur schwer verständlich, aber gerade hierin umso wirksamer – spontan ein: Die «Auseinandersetzung mit Gewalt sei immer eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Gewaltpotential», und das ist ganz und gar nicht pädagogisch gemeint. Vielmehr erhellt Mehrs Einwurf ein Konzept der Souveränität einer Frau, die sich weigert, das Opfer zu sein (oder zu bleiben), das die Welt aus ihr machen möchte. Den Zustand der Gnade erreicht diese Literatur gerade in der Gnadenlosigkeit.
Überzeugen kann man sich von dieser in der Schweizer Gegenwartsliteratur einzigartigen Furiosität seit dem vergangenen Jahr wieder anhand zweier im Limmat Verlag erschienener Bände, von denen der eine Mehrs Trilogie der Gewalt (Daskind [1995], Brandzauber [1998] und Angeklagt [2002]), der andere – unter dem Titel Widerworte von Christa Baumberger und Nina Debrunner herausgegeben – Mehrs journalistisches Werk, ihre Gedichte und Reden vorstellt. Insbesondere die Rezensionen, überhaupt: ihre lesende Biographie kommt hier erstmals eindrucksvoll zum Vorschein und ist mehr als ein Zeitdokument. Ein ganz eigenes, in seiner Metaphorik originelles wie hellsichtiges Verständnis von Literatur zeigt sich hier – als Beispiel sei hier die hingebungsvolle wie kämpferische Auseinandersetzung mit Hermann Burgers Die künstliche Mutter genannt.
Wenn die Gefahr der unfreiwilligen Remarginalisierung Mariella Mehrs auch diesen Morgen einmal heimsuchte (in jenem kurzen Moment, in dem ihre Lyrik unmerklich zur Versprachlichung erlebter «Heimatlosigkeit» heruntergebrochen wurde), so gilt es den Veranstalterinnen dennoch vorbehaltlos und nachdrücklich für diese überfällige Hommage zu danken.
Am 16. Juni wird Mariella Mehr in Glarus/Ennenda der Anna-Göldi-Menschenrechtspreis verliehen werden.