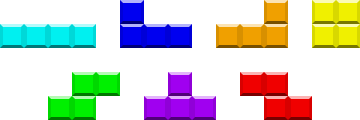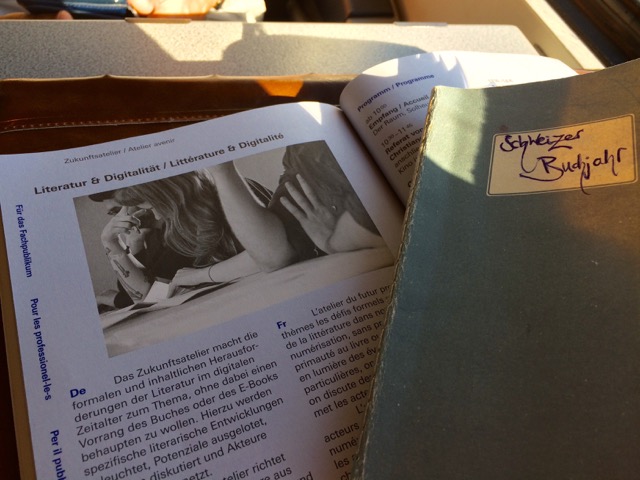Die Demokratie zur Kritik freizugeben, ist Teil ihres Wesens. Demokratische Wahlen abschaffen zu wollen, erweckt im Land der Totaldemokraten hingegen Angst um die eigene Identität. David Van Reybrouck, dessen vieldiskutierte Thesen aus „Gegen Wahlen“ als Grundlage der am Samstagabend in Solothurn angesetzten Podiumsdiskussion „Demokratie in der Krise“ dienen, spricht den Wahlen ihren demokratischen Charakter ab und bezeichnet sie als Instrument der Aristokratie. Die Auffassung von der Demokratie in der Krise teilen auch Lukas Bärfuss (Autor) und Ruth Dällenbach (Politische Konsulentin, Präsidentin „Denknetz“); den Weg zur Besserung vermuten sie aber hinter verschiedenen Türen.
Moderator Felix Schneider eröffnet die Diskussion mit der Frage, welche Symptome es für die Krise gebe. Van Reybrouck beginnt Statistiken aufzuzählen, nach welchen Bürger den Grossteil des Vertrauens in Parteien und Politiker verloren hätten – und das auch in Europa. Damit stecke das Wahlverfahren in einer Legitimationskrise, was Dällenbach allerdings sogleich dementiert. Es sei eine Effizienzkrise und die Frage sei eher, wer alles worüber entscheiden darf. Bärfuss folgt ganz anderen Gedankengängen und lokalisiert das Problem in dem obsoleten Konzept des Nationalstaats, da es ja willkürlich sei, den Wahlkreis aufgrund der Nationalität zu ziehen. Die Frage aber bleibt: Wem vertrauen die Bürger noch?
Zwar sieht Bärfuss die Problematik in institutionellen Mittelstufen zwischen Lokalität und Globalität (beispielsweise der Nationalrat stand heftig unter Beschuss), die von der Wirklichkeit überholt worden seien, trotzdem bekennt er sich in vielen Punkten als ausgesprochener Sympathisant Van Reybroucks. Das ungeregelte Zusammenkommen eines Volkes führe immer zu Revolutionen, was Repräsentanten unabdingbar mache. Durch Wahlen sei aber die Angst vor der nächsten Wahl eine gewaltigere Kraft denn die Wirkung der vergangenen. Die Idee funktioniert wie folgt: Das Interesse des Politikers ist es, gewählt zu werden, weshalb er sein Programm den Interessen der Wählerschaft anpasst, insofern diese überhaupt die besten Richter ihrer eigenen Interessen sind. Van Reybroucks Vorschlag ist nun, ein vielfältiges Gremium (Geschlecht, Alter, Soziale Klasse, Wohnort) durch Zufall auszulosen. Besser weniger kompetent und frei, als kompetenter und unfrei.
Dällenbach stemmt sich nun gegen diese Logik mit der Frage, wo die Kraft der Bevölkerung bleibe. Wer Bürgern die Kompetenz zur Wahl abspreche, könne ihnen doch nicht die Kompetenz zur Politik zusprechen. Ja, Lobbyismus und Wahlkampfverfahren müssen kontrolliert und reguliert werden, und ja, das Elektorat müsse ausgeweitet werden. Für all das gebe es aber basisdemokratische Wege, die auf das Engagement der Bürger bauen. Die politische Partizipation sei durch Bildung des Demos, nicht durch Zwang zu erreichen.
Die Veränderung ist nicht gefährlich, aber keine Veränderung ist es. Ob diese das Entscheidungsverfahren an sich oder eine Alternative bedeutet, ist zwar keineswegs eine neue, durchaus aber eine entscheidende Frage. Vor allem die Schweiz muss sich immer wieder bewusst machen, dass die Demokratie als Mittel notwendigen Änderungen offenstehen muss und darf sie nicht zum Zweck überhöhen.
Lukas Bärfuss und David Van Reybrouck treffen sich am 30. Mai im Schauspielhaus Zürich zu einer weiteren Diskussion zum Thema.